Unser Beitrag "War
der Brunenbauer Georg Bausch ein Meisterfälscher ?" und der am
04.07.2002 im "Hanauer Anzeiger" unter der Überschrift "Original
oder Fälschung ?" erschienene Beitrag hat das Interesse vieler
an der Vorgeschichte unseres Raums interessierten Personen an dieser lange
zurückliegenden "Fälscher-Story" geweckt. Um sie mit der Materie
etwas näher vertraut zu machen, hat der Geschichtsverein Windecken
2000 die in seinem Archiv vorhandenen Quellen der "Heimatliteratur" ausgewertet.
Nachfolgend werden chronologisch die bandkeramischen "Wetterauer Brandgräber"
betreffenden Passagen aufgeführt. Die Besucher unserer Website werden
gebeten, ihnen bekannte weitere Quellen zu benennen, damit wir sie in dieses
Verzeichnis aufnehmen können.
Die südliche Wetterau in vor- und frühgeschichtlicher
Zeit mit einer archäologischen Fundkarte von Georg Wolff. Herausgegeben
von der Römisch-Germanischen Kommission des Kaiserlich Archäologischen
Instituts 1913
A. Allgemeiner Teil. I. Die Besiedlung der Südwetterau
in vor-und frühgeschichtlicher Zeit S. 5,6
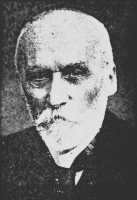 |
| Grossansicht laden | © GVW 2000 |
Professor Georg Wolff (1845-1929) wird auch als der "Nestor er Wetterauer archäologischen Bodenforschung" bezeichnet.
Repro: Rolf Hohmann
|
"Es war längst aufgefallen, daß zu der großen Mehrzahl
der Ansiedelungen mit Bandkeramik die zugehörigen Gräber fehlten.
Wo sich solche gefunden haben, da waren es tiefe Flachgräber mit Skeletten:
Brandgräber waren nur vereinzelt in Nord-und Osteuropa, besonders
in Rössen bei Merseburg gefunden, hier in Verbindung mit Gefäßen,
die durch ihre tiefe Furchen-und Stichornamente eine Beeinflussung durch
die Keramik der nordischen Megalithgräber zu verraten schienen."
Hatte man doch noch vor wenigen Jahren Leichenverbrennung für die
jüngste Steinzeit überhaupt vielfach geleugnet und ihren Anfang
in die Bronzezeit verlegt. Nun haben sich aber auf dem Lößplateau
der "hohen Straße", welches sich östlich von Frankfurt zwischen
der Mainebene und der Wetterau bis zu den Ausläufern des Vogelsberges
hinzieht, in einer Landschaft, in der vor 12 Jahren noch keine Spur einer
neolithischen Niederlassung nachgewiesen war, im letzten Jahrzehnt in allen
Gemarkungen Wohngruben aus der jüngeren Steinzeit mit bandkeramischem
Inhalt gefunden, und zwar so zahlreich wie aus keiner anderen Periode der
Prähistorie und zu Gruppen vereinigt, die an Ausdehnung z.T. den stattlichen
modernen Dörfern fast gleichkommen.
Diesen Funden sind in den beiden letzten Jahren ebenso zahlreiche in
fast allen Gemarkungen Großfrankfurts gefolgt. Die Reste der Wohnungen
bestehen hier wie dort aus flachen Vertiefungen im Boden von verschiedener
Größe und durchaus unregelmäßiger Form, in welche
eine oder mehrere kreisrunde oder ovale Gruben tiefer eingeschnitten sind,
die sich nach ihrer Beschaffenheit und ihrem Inhalte teils als Herdgruben,
teils als Aufbewahrungsräume bestimmen lassen. Daß über
ihnen leichte Fachwerksbauten aufgeführt waren, beweisen die zahlreichen
Lehmpatzen mit den Röhren der Holzverstakung und den Abdrücken
von Stroh oder Binsen und neuerdings gefundene Pfostenlöcher.
Unter dem Boden dieser Hütten und neben ihnen sind zahlreiche Brandgräber,
im letzteren Fall oft so dicht unter der Oberfläche gefunden, daß
sie teilweise vom Pfluge zerrissen waren, was zweifelsohne bei vielen anderen
seit Jahrhunderten geschehen ist, ohne daß man von ihrem Vorhandensein
Notiz genommen hat. In den Hütten wie in den Gräbern aber haben
wir bisher unbekannte Halsketten aus punktverzierten Kieseln und Anhänger
aus Tonschieferplättchen oder zurückgeschnittenen Gefäßscherben
gefunden, wozu in den letzten Monaten in der Umgebung von Frankfurt Ketten
aus gebrannten Tonperlen und Anhänger aus Knochen und perlmutterartigen
Muschelstücken gekommen sind. Nun ist aber die gleiche Keramik mit
ähnlichen Schmucksachen in letzter Zeit auch weit entfernt in Diedmarden
bei Göttingen und in Thüringen, nicht weit von Rössen, gefunden,
wo vor 10 Jahren die ersten Brandgräber zweifelndes Erstaunen erweckt
hatten".
B. Spezieller Teil - Fundstellen nach Gemarkungen geordnet
Rüdigheim S. 72,73
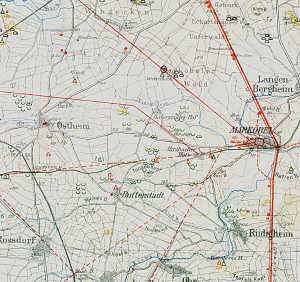 |
| Grossansicht laden | © GVW 2000 |
Ausschnitt aus der archäologischen Fundkarte der südlichen Wetterau aus dem Jahr 1912. Bearbeitet von Professor Georg Wolff
Repro: Rolf Hohmann
|
"Die Funde bewiesen bei der Unbestimmtheit der Ortsangaben nur, daß
das Gemarkungsgebiet in verschiedenen Perioden der jüngeren Steinzeit
bewohnt war, Wohnstätten und Gräber fehlten bis zum Frühjahr
1910 völlig. Da stellten beide sich auf dem erwähnten Judenberge
ein. Auf seinem oberen, östlichen Teile wurden Gruben mit Scherben
des Rössen-Niersteiner Typus angeschnitten. Am unteren Abhange nach
den Krebsbachwiesen hin konnten im Herbste mehrere Wohngruben von den in
der Wetterau allein üblichen unregelmäßigen Form, darunter
eine 31 m lange, vollständig aufgedeckt werden. In der Grube und in
ihrer Nähe wurden Brandgräber mit je zwei dreieckigen Anhängern
gefunden, die aus linearverzierten Scherben derselben Art, wie sie in den
Gruben neben Gebrauchsgegenständen und Hüttenlehm vorkamen. Neben
einem der Gräber fand sich die zu ihm gehörige vertiefte Verbrennungsstätte.
Ein auf dem oberen Teil des Judenberges unter dem Inhalt einer Grube gefundener
Anhänger trug wie alle an dieser Stelle gefundenen Scherben die Tieffurchenstiche
des Rössen-Niersteiner Typus, außerdem aber auf der anderen
Seite ein gabelförmiges Zeichen, welches erst bei seiner Herstellung
als Amulett eingeschnitten war. Vgl. Prähist. Zeitschr. III 1911 S.34ff."
Marköbel mit den Hirzbacher Höfen S. 75
"Im westlichen Teile der Gemarkung, wo die Grenze jetzt zugunsten des
selbständigen Gutsbezirkes Baiersröder Hof nach Osten vorgeschoben
ist, sind in den Jahren 1907 und 1908 an der neuen Grenze südlich
von dem Wiesentälchen "Steinweide" und weiter nördlich auf dem
"Röderfeld" zahlreiche Brandgräber der jüngeren Steinzeit
mit Halsketten aus verzierten Kieseln und neben ihnen ebensolche Wohngruben
mit Liniarbandkeramik, vereinzelt mit Scherben des Großgartacher
Typus, gefunden und aufgedeckt worden Vgl. Prähist. Zeitschr. III
1911 S. 11ff.
1 km südlich des Baiersröder Hof, 150-200 m östlich
von der Kreuzung des Butterstadter Weges mit der Chaussee Ostheim-Marköbel,
wurden im Mai 1912 an der Nordseite der Chaussee bei der Verschiebung des
Straßengrabens drei neolithische Gruben und ein Brandgrab durchschnitten.
Aus der Branderde des letzteren wurde in meiner und Dr. W. Müllers
Gegenwart eine spinnwirtelförmige Tonperle erhoben, wie sie in den
letzten Jahren bei Frankfurt, aber noch nicht im Hanauer Gebiete in neolithischen
Gräbern als Bestandteile von Halsketten gefunden sind. Vgl. Altfrankfurt
II 4 s. 117 und Abb. 1 und 2: IV 1 S. 22ff und Abb. 1-4.
Neolithische Gruben waren auch südlich und östlich von den
Hirzbacher Höfen in den Jahren 1903 und 1906 gefunden, 200 m südwestlich
vom südlichsten Hofe in der Gewann "Kammerborn" mit Großkartacher
Keramik und dreieckigen, breitnackigen Steinbeilen. Ein ganz erhaltenes,
mit Stich-und Strichornamenten ganz überdecktes und mit Buckeln am
Bauchknick versehenes Urnchen, welches im Jahre 1903 vom Vorarbeiter Bausch
gefunden und ins Hanauer Museum verbracht war, dürfte, da es nach
Angabe des Finders die noch vorhandenen kalzinierten Knochen enthalten
hatte, zu einem Brandgrab gehört haben. Denn auch von Marköbeler
Gräbern hatten zwei zerdrückte, aber in ihren Bestandteilen vollständig
erhaltene Großkartacher Gefäße enthalten, in welchen dort
freilich nicht die Knochenreste geborgen waren. Vgl. Prähist. Zeitschr.
a. a. 0. S. 32".
Baiersröder Hof S. 78
"Das Feld im westlichen Teil des großen Gutsbezirks zwischen der
Ostheim-Marköbeler Chaussee und dem "Firzenfluß" ist bedeckt
von neolithischen Gräbern und Gruben mit Linearband-und Rössen-Großgartacher
Keramik. Die ersten wurden im Jahre 1903//04 von Bausch gefunden und von
uns aufgenommen. Im Jahre 1907 wurden mehrere untersucht, im Jahre 1909
eine Grube mit Großgartacher Scherben, ornamentierten Doppelanhängern
aus Tonschiefer und einem Brandgrab mit Kieselkette und Großgartacher
Gefäßscherben vollständig von Verworn und Heiderich ausgegraben.
Vgl. Prähist. Zeitschr. III 1911 S. 26Ff und Anthropol. Korrespondenzbl.
XLI Nr. 1/3 1910 S. 9Ff und S.13ff. Neuerdings wurden auf denselben Äckern
im Winter 1911/12 wieder viele Gruben aufgerissen. Auch weiter östlich
sind im Jahre 1907 an beiden Seiten des von Butterstadt nach dem Hofe führendes
Weges, etwa 200 m südlich und südwestlich vom Hofe Gruben gefunden,
westlich vom Wege mit Großgartacher, östlich mit linearverzierten
Scherben (Spiral-Mäander-Keramik nach Köhl). Endlich fanden sich
im Jahre 1908 zahlreiche Gräber und Gruben mit beiden Gattungen der
Bandkeramik (getrennt) an der Ostseite des Gutsbezirkes, unmittelbar neben
den unter "Marköbel" erwähnten, sowohl auf dem "Röderfeld"als
südlich von der "Steinweide".
Butterstadt S. 78, 79
"Über die vor dem Jahre 1903 an der hohen Straße gefundenen
Reste aus der jüngeren Steinzeit hat Prof. Küster auf der vierten
Versammlung des Südwestdeutschen Verbandes f. r.-g. A. In Mainz 1903
berichtet. Vgl. das Protokoll im Korrespondenzblatt des Gesamtvereins der
d. G. u. A. 1903 S. 240ff. Der aus mehreren Höfen bestehende Weiler
trat erst im Jahre 1900 durch die Auffindung einer römischen Gigantensäule
und die baldige Aufdeckung zahlreicher neolithischen Wohngruben in die
Reihe der archäologischen Fundstellen des Hanauer Landes, unter welchen
er bald eine hervorragende Stelle einnehmen sollte. Die ersten neolithischen
Wohngruben mit Linearband-und Rössen-Niersteiner Scherben wurden in
der Umgebung der Gigantensäule auf dem Grundstück von C. Toussaint,
320 m nordwestlich vom Weiler, gefunden. Vgl. Hess. Mittl. 1902 S. 18,
4 und Fundakten des M.H.
Von der größten Bedeutung aber waren Funde, welche auf dem
"Tannenkopf" (nicht auf dem "Braunsberg") gemacht wurden. Hier sind auf
den ausgedehnten Ackerbreiten des Gutsbesitzers Jung zu beiden Seiten des
langen Feldweges, der von dem östlichen Knie des Weges nach dem Baiersröder
Hofe geradlinig nach Osten zieht und der ehemals hier noch erkennbaren
"hohen Straße" fast genau entspricht, neben Gräbern und Gruben
der späten Latène-Zeit und Einzelfunden aus der römischen
Periode bereits im Jahre 1902, dann wieder 1903 zahlreiche Gruben mit Steingeräten,
Mühlsteinen und Scherben beider bandkeramischen Kulturen vom Pfluge
aufgerissen worden, deren Inhalt von dem damals noch privatim suchenden
Arbeiter G. Bausch in die Hanauer Sammlung verbracht wurde. (In den Eingangsverzeichnissen
des M.H. ist mehrfach fälschlich der "Braunsberg" als Fundstelle angegeben
worden. Derselbe liegt weiter südöstlich an der Marköbeler
Grenze."
"Im Winter 1906/07 wurden dort (Tannenkopf) die ersten Brandgräber
mit Halsketten aus durchbohrten und zum Teil punkt-und strichverzierten
Kieseln gefunden und genau aufgenommen. Ihnen folgten in den nächsten
Jahren viele andere in demselben Distrikt und bald auch an der nördlichen
Gemarkungsgrenze und über diese hinaus. Zu den Kieselketten
kamen im Jahre 1910 auf dem ergiebigen Gebiete des Tannenkopfes auch Anhänger
aus Tonschiefer, in einem Falle mit Kieseln zu einem Hängeschmuck
vereinigt. Vgl. V. Bericht der Röm.-Germ. Kommission S. 8. Die Keramik
gehörte größtenteils der lienarverzierten Gruppe an. Vgl.
Prähist. Zeitschr. III 1911 S. 1ff."
Ostheim S. 80
 |
| Grossansicht laden | © GVW 2000 |
Brandgrab der jügeren Steinzeit bei Ostheim mit einer Kieselkette in der
ursprüglichen und unberührten Lage, während der Ausgrabung 1909.
Die hellen Stellen innerhalb der Steinkette sind unverbrannte Knochenstücke.
(Aus: "HANAU Stadt und Land" von Ernst J. Zimmermann).
Repro: Rolf Hohmann
|
"Auf dem "Heckenwingert", dem westlichsten Teil des Ostheimer Feldes,
welches sich von der römischen Straße Saalburg-Marköbel
abdacht, waren bereits 1903 bei Begehungen zahlreiche dunkle Flecke aufgefallen,
die durch ausgepflügte Scherben und Handmühlsteine auf das Vorhandensein
neolithischer Wohngruben schließen ließen. Aber erst im Jahre
1909 konnten auf einem Grundstücke des Ökonomen Wilhelm Stein
Grabungen vorgenommen werden, bei welchen mehrere Wohngruben und ein Grab
mit stich - und strichverzierten Kieseln aufgedeckt wurden. Vgl. Prähist.
Zeitschr. III 1/2 1911 S. 24ff. In den Gruben kamen ausschließlich
linearverzierte Scherben neben Anhängern aus Tonschiefer mit Punkt
- und Lienearornamenten vor."
Windecken S. 90
"Sehr ergebnisreich waren die Ausgrabungen, welche im Winter 1908/09
auf den Grundstücken von Diegel und Weimel zwischen dem Bahnkörper
westlich der Haltestelle Windecken und der Landwehr (Landesgrenze), 200
m westlich von der Heldenbergener Chaussee vorgenommen wurden. Etwa 30
Wohngruben wurden an - und zum Teil vollständig ausgegraben. Die gefundenen
Scherben zeigen die Formen und Verzierungen der Eichelsbacher Gruppe der
Linearbandkeramik. Unter den übrigen Funden zeichnete sich eine aus
Doppelanhängern von Tonschiefer mit Strichverzierungen zusammengesetzte
Halskette aus. In Brandgräbern fanden sich drei Doppelanhänger
mit Strich-und Punktverzierungen, gleichfalls aus Tonschiefer."
Kilianstädten S. 95
"Über die im Jahre 1908 im Kilianstädter Walde, dicht an der
Landesgrenze und 400 m südöstlich von der Haltestelle Büdesheim
der Vilbeler-Heldenbergener Bahn, aufgedeckten neolithgischen Brandgräber
mit Anhängern von Tonschiefer und Tierzähnen als Beigaben sowie
linearverzierten Scherben vgl. man Prähist. Zeitschr. III 1911 S.
16 mit Taf. 1-20 (Wolff) und Festschrift zur Vers. der Deutschen Anthropol.
Gesellsch. Frankfurt a.M. 1908 S. 13ff. (Steiner)"
HANAU Stadt und Land - Kulturgeschichte einer fränkisch-wetterauischen
Stadt und ehemal. Grafschaft. Mit besonderer Berücksichtigung der
älteren Zeit. Von Ernst. J. Zimmermann. Unveränderter Nachdruck
der vermehrten Ausgabe von 1919
Einleitung
"Ornamentierter Steinhalsschmuck der jüngeren Steinzeit (ca. 2000
v. Chr.) Aus Brandgräbern der Umgebung Hanaus. Im Museum des Hanauer
Geschichtsvereins. Gefunden 1907 bis 1910 (Foto)
Typen der ornamentierten Steinketten aus der jüngeren Steinzeit
im Hanauer Geschichtsvereins=Museum (Foto ). Vgl. hierzu auch die Abb.
der drei oberen Ketten auf der Vorderseite. Sämtlich flache Kieselsteine,
nur Nr. 5 Schieferplättchen. Aufgenommen u. gez. von Ernst J. Zimmermann.
 |
| Grossansicht laden | © GVW 2000 |
Typen der ornamentierten Steinketten aus der jüngeren Steinzeit im Hanauer
Geschichtsvereins-Museum. Sämtlich flache Kieselsteine, nur Nr. 5 Schieferplättchen.
(Aus: "HANAU Stadt und Land" von Ernst J. Zimmermann).
Repro: Rolf Hohmann
|
Die Ornamentierung (auf beiden Seiten) besteht entweder in vertieften,
eingeschliffenen Strichen oder Punkten (mit dem Drillbohrer hergestellt)
oder in Strichen und Punkten. Die einzelnen Steinchen waren nicht so eng
aneinandergereiht, wie auf der Vorderseite dargestellt ist, sondern wie
sich aus der Lage der Steinchen bei der mit Sorgfalt geführten Ausgrabung
(Foto 3) feststellen ließ, 4 bis 5 mm voneinander entfernt. Innerer
Durchmesser war etwa 20 bis 22cm, sodaß die Kette bequem über
den Kopf gestreift werden konnte. Die Bestattung der Asche geschah in der
Weise, daß eine runde Grube von etwa 0,50 bis 0,60 m oberer und ebensolcher
Tiefe gegraben wurde, auf deren flachen, aber nicht sehr genau geebneten
Boden (vgl die Abb,) man die Steinkette - so gut dies ging sorgfältig
ausgebreitet hat, um in dem Zwischenraum, der inneren Oeffnung des Schmuckes,
die Asche mit den Knochenresten des Verbrannten aufzuhäufen. Letzeres
geschah, nach der fast kreisrunden Form der tiefdunkelrotbraunen Farbe
im Erdboden, welche die Asche hinterlassen, zu schließen, vermutlich
in einem Säckchen, das durch Aufschüttung der Erde platt gedrückt
wurde, aber rund blieb und von dem, wie auch von den Fäden, Pferdehaaren
oder Sehnen, mit denen die Kette zusammenhing, natürlich im Verlauf
der Jahrtausende nichts übrig geblieben ist. Verschiedene Halsketten
tragen am Mittelglied als Anhänger ein Steinchen von phallischer Form,
das wohl symbolische Bedeutung, Beziehung zur Fruchtbarkeit hat."
Chronik der Gemeinde Ostheim 1974
Kapitel: Unsere Heimat in vorgeschichtlicher Zeit. S. 9
"Ließ sich der Feuerstein schlecht durchbohren, so benutzte man
zu Schmucksteinen weicheres Material. Eine derartige Kieselkette, deren
Material wahrscheinlich aus dem Main stammen dürfte, wurde unversehrt
in einem Brandgrab gefunden, das zu einer neolithischen Siedlung nördlich
von Ostheim gehörte."
1150 Jahre Marköbel - 850 Jahre Baiersröderhof
(Hammersbach 1989)
Kapitel: Bodenfunde berichten aus der vorgeschichtlichen Zeit S.
2,3
"Zahlreiche Fundstellen in der Gemarkung von Marköbel zeigen, daß
die Bandkeramiker auch hier siedelten. "Am Kammerborn" nahe den Hirzbacher
Höfen fand man 1903 und 1906 verzierte Scherben, ein großes
unverziertes Gefäß und Steingeräte, ebenso am "Baiersröderhof",
westlich des Hofes zwschen der Ostheim-Marköbeler Straße und
dem Firzenfluß. Zwei restaurierte Gefäße von dieser Fundstelle
zeigen sehr deutlich bandartige Verzierung. Eine markante Fundstelle liegt
an der Straße nach Ostheim auf dem Gebiet des Baiersröderhofes.
Diese sogenannten "WETTERAUER BRANDGRÄBER" beschäftigen die Wissenschaftler
mehrere Jahrzehnte und waren zu Anfang unseres Jahrhunderts eine archäologische
Sensation. Doch wurden nach 1920 keine Gräber mehr gefunden, nachdem
der Entdecker der Brandgräber, der Windecker Brunnenbohrer Bausch,
seine Ausgrabungstätigkeit einstellte. Der wichtigste Fund innerhalb
dieser Gräber waren Ketten aus Kieselsteinen. Diese Ketten waren es
auch, die diese Gräber nach heutigem Wissenstand als Fälschung
entlarvten. Denn Bohrer, mit denen solche kleinen Löcher hätten
gebohrt werden können, gab es z.Zt. der Bandkeramik nicht (Diese bestanden
aus Feuerstein oder Quarzit, aber nicht aus Stahl)."
Führer zu archäologischen Denkmälern
in Deutschland
Hanau und der Main-Kinzig-Kreis (1994)
Kapitel: Die Besiedlung des Main-Kinzig-Kreises von der Jungsteinzeit
bis in die Eisenzeit S.44
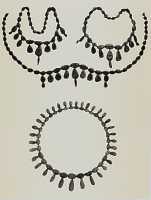 |
| Grossansicht laden | © GVW 2000 |
Ornamentierter Steinhalsschmuck der jü:ngeren Steinzeit (ca. 2000 vor Chr.)
Aus Brandgräbern der Umgebung Hanaus. Im Museum des Hanauer Geschichtsvereins.
Gefunden 1907 bis 1910.
(Aus: "HANAU Stadt und Land" von Ernst J. Zimmermann).
Repro: Rolf Hohmann
|
"Die Angang des 20. Jahrhunderts im Untermaingebiet und besonders häufig
im Gebiet des heutigen Main-Kinzig-Kreises entdeckten "Wetterauer Brandgräber"
erwiesen sich in den fünfziger Jahren endgültig als Fälschung
und "echte" Brandgräber, die, wie schon anderenorts beobachtet , vorherrschende
Bestattungssitte der LBK konnten in ganz Hessen noch nicht nachgewiesen
werden. Einzig belegt sind in Hessen einzelne Körperbestattungen ,
d.h. Hockergräber mit Keramik-, Stein-und Knochengerät sowie
Muschelschmuck-Beigaben in Siedlungen. Aber auch diese fehlen im Main-Kinzig-Kreis."
Chronik Ostheim - Ein Stadtteil von Nidderau im Jahr
2000
Herausgegeben von der Stadt Niderau als Band 9 in
der Reihe "Nidderauer Hefte"
Kapitel: Vor-und Frühgeschichte - Archäologisches aus der
Ostheimer Gemarkung S. 16
"Trotz sporadischer Nachsuche haben alte Fundmeldungen vom Baiersröderhof
(Anmerkung 15: Wolff 1913, 78; Kutsch 1926, 26, W. Meier-Arendt 1966, 124f.
(unter Marköbel) bisher keine nähere Eingrenzung oder Bestätigung
gefunden. Bei den von dort berichteten bandkeramischen "Brandgräbern"
handelt es sich, wie bei allen diesbezüglichen Fundmeldungen aus der
Region, um klare Fälschungen, wobei Wolffs Vorarbeiter G. Bausch wohl
zu Unrecht bezichtigt wird (Anmerkung 16: G. Loewe 1958. Einigen Windecker
Bürgern ist der eigentliche Übeltäter noch in Erinnerung;
den Namen konnten wir aber nicht in Erfahrung bringen."
Nachbetrachtung: Seit Veröffentlichung des Buches von Profesor
Georg Wolff sind 90 Jahre vergangen. Auch in der archäologischen Bodenforschung
ist die Zeit nicht stehen geblieben.
Dendrologie, C-14-Bestimmung, Elektronenmikroskopie und in jüngster
Zeit die Gentechnik haben das Wissen über die in der Praehistorie
lebenden Menschen in einem kaum vorausschaubaren Maße erweitert.
So können wir uns heute ein wesentlich besseres Bild von den
in unserem Raum siedelnden, nach den Verzierungen ihrer Tongefässe
genannten "Bandkeramikern" machen, als dies den Archäologen zu Beginn
des 20. Jahrhunderts möglich war. Über den heutigen Stand der
Wissenschaft auf diesem Spezialgebiet soll in einem gesonderten Beitrag
berichtet werden.
|



