| In allen bisher bekannten Abhandlungen, die sich kritisch mit den Wetterauer
Brandgräbern und der Rolle des Windecker Brunnenbauers Georg Bausch
befassen, wird über das eigentliche Geschehen auf den jeweiligen Fundplätzen
nur in wenigen Sätzen berichtet. Um auch den interessierten Laien
eine Vorstellung einer archäologischen Ausgrabung zu Beginn des vorigen
Jahrhunderts zu vermitteln, wird der Geschichtsverein Windecken in Folge
Berichte von damals handelnden Personen im Wortlaut veröffentlichen.
Nur so ist gewährleistet, daß sich die Besucher unserer Homepage
eine unbeeinflusste Meinung bilden können.
Wir beginnen mit dem Abdruck eines Vortrags, den Professor F.K. Heiderich
am 21. Mai 1909 in einer Sitzung des Anthropologischen Vereins Göttingen
hielt. Sie wurde im Band 41 des Korrespondenz-Blattes der Deutschen Gesellschaft
für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte veröffentlicht:
"Die Grabungen, über die zu berichten ich heute die Ehre habe,
wurden veranlaßt durch zwei Publikationen von Herrn Prof. Wolff in
Frankfurt a.M., worin dieser Brandgräber aus der jüngeren Steinzeit,
speziell aus der Kulturperiode der Bandkeramik, beschreibt. Sie wissen
aus einem früheren Vortrage, den Herr Prof. Verworn hier im Verein
gehalten hat, daß man aus dieser Kulturperiode zwar eine ganze Menge
von Ansiedelungen in den verschiedensten Gegenden kennt, daß es aber
bei einer großen Reihe dieser Ansiedelungen bisher, trotz genauer
Forschung, noch nicht gelungen ist, die Grabstätten aufzufinden.
Nach dieser Richtung hin hat also die Wolffsche Entdeckung große
Bedeutung. Uns hier in Göttingen interessieren die Funde deswegen
noch ganz besonders: denn die Ansiedelungen in der hiesigen Gegend, z.B.
bei Diemarden, gehören derselben Kulturperiode an, aber auch hier
ist das Suchen nach Grabstätten bis jetzt vergeblich gewesen. Wir
wandten uns daher an Herrn Prof. Wolff mit der Bitte, uns eine Grabung
in dortiger Gegend zu ermöglichen, da wir glaubten, durch eine genaue
Untersuchung dieser Grabstellen Anhaltspunkte in hiesiger Gegend gewinnen
zu können. Herr Prof. Wolff kam uns in der liebenswürdigsten
Weise entgegen und stellte uns den Arbeiter, der die ersten Brandgräber
ausgegraben hatte, für unsere Grabung zur Verfügung.
So konnten wir dann am 3. Osterfeiertag mit der Grabung beginnen. Die
Ausgrabungsstellen liegen in den Gemarkungen Butterstadt und Domäne
Baiersröder Hof. Sie sind von der Station Ostheim der Hanau-Friedberger
Bahn in etwa 3/4 Stunden zu erreichen. Die Lage der Ansiedelungen ist ganz
typisch für diese Zeitepoche. Sie befinden sich an einem flach abfallenden
Hügel, gehen aber noch bis in das Tal hinunter. Im Tal fließt
ein kleiner Bach. Der Boden ist fruchtbar, ist tiefgründiger Lehmboden.
Also genau dieselben örtlichen Verhältnisse wir auch hier in
Diemarden, wie an zahllosen anderen Stellen derselben Kulturperiode. Die
Wohnstellen waren an der Erdoberfläche deutlich als große dunkle
Flecke zu erkennen.
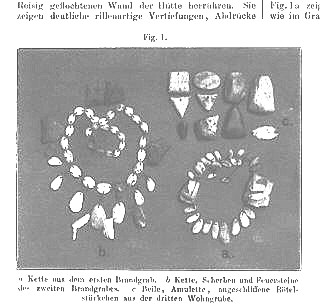 |
| Grossansicht laden | © GVW 2000 |
|
Die in den Gräbern und Gruben gefundenen Beigaben.
Repro: Rolf Hohmann
|
Als ich am ersten Morgen über die Felder ging, war ich erstaunt,
wie stark an Wohnstellen besetzt jene Gegend war. Der Vorarbeiter Bausch
hatte bereits zwei Stellen für die Grabung vorbereitet und Versuchsgräben
angelegt. Bei der Vertiefung des ersten Versuchsgrabens schon stießen
wir auf ein Brandgrab. Wir ließen dieses vorläufig unberührt
und gruben erst die Wohnstelle in der ganzen Ausdehnung frei. Sie war ziemlich
kreisrund angelegt und hatte einen Durchmesser von 5,20m bei einer Tiefe
von 1 m unter der Ackeroberfläche. In dem nordöstlichen Teile
der Grube fand sich eine fast kreisrunde Vertiefung, deren Durchmesser
1,80 m betrug und deren Boden 30 cm tiefer lag als der Boden der großen
Grube. An dieser Stelle schloß sich eine parallelwandige Verlängerung
der Grube an, welche 85 cm breit und 1,40 m lang war. Hier mag wohl die
Feuerstelle gewesen sein, denn hier fanden sich viele Holzkohlestückchen,
einige Lehmbrocken, die im Feuer gewesen waren, und viele Scherben großer,
ganz roh gearbeiteter Gefäße.
Außerdem lagen hier einige Stücke eines glimmerhaltigen Gesteins,
das wohl bei der Herstellung von Kochgefäßen mit verwandt
werden sollte, wenigstens weisen die gefundenen Scherben darauf hin, da
sie viele Glimmerstückchen enthalten. Im ganzen Umkreis der Grube
fanden sich Lehmstücke, die von dem Bewurf der aus Reisig geflochtenen
Wand der Hütte herrührten. Sie zeigen deutlich rillenartige Vertiefungen,
Abdrücke der Holzstäbe der Wand. Im übrigen suchten wir
vergebens nach Scherben und Steingerät in der Grube. Ich war deshalb
anfangs, ehe ich die Herdstelle gefunden hatte, im Zweifel, ob dies wirklich
eine bewohnte Grube gewesen sei oder nicht nur eine Grabstelle. Ich glaube
aber, daß sich das Fehlen von sonstigen Gerätschaften sehr einfach
durch die Annahme erklären läßt, daß die Bewohner
der Grube dieselbe nach Anlage des Grabe verlassen und dabei natürlich
ihr sämtliches brauchbares Gerät mitgenommen haben.
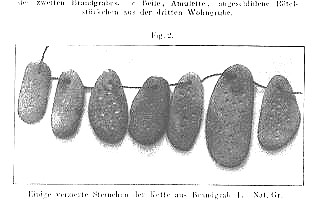 |
| Grossansicht laden | © GVW 2000 |
|
Einige durchbohrte und mit Punktverzierungen versehene Mainkiesel. Der Faden aus Omas Nähkörbchen diente der Demonstration.
Repro: Rolf Hohmann
|
Das Grab hob sich von dem gelben Lehm der Umgebung deutlich durch seine
intensiv schwarze Farbe ab. Die Begrenzung war eine ganz scharfe. Es hatte
eine ovale Form, war 35,5 cm lang und 32 cam breit. Die schwarze, erdige
Masse, aus der es bestand, war unzweilhaft Leichenbrand. Die war durchsetzt
von gebrannten Knochenstückchen und Kohle. Bei vorsichtiger Entfernung
der schwarzen Erde kamen wir sehr bald auf kleine ovale Steinchen, die
an einem Ende durchbohrt sind und im Kreis angeordnet lagen. Es fanden
sich insgesamt 30 Steinchen von verschiedener Größe vor. Sie
waren genau der Größe nach geordnet und zwar so, daß die
größeren in der Mitte lagen: die elf größten Steinchen
sind durch kleine Pünktchen sehr hübsch verziert.
Die Steinchen gehörten wohl zu einer Kette zusammen und stellten
den Schmuck des Menschen dar, dessen Asche hier bestattet ist. An zwei
Stellen, und zwar in der Ostwestrichtung orientiert, lagen unter den Steinchen
der Kette Bruchstücke von zwei Steinbeilen, von denen eins neu angeschliffen
ist. Nach Entfernung der gesamten Aschenreste stellte sich heraus, daß
dieselbe in in einer flachen, tellerartigen Grube gelegen hatten. Die Kette
lag fast auf dem Grunde der Grube, ist also zuerst hineingelegt worden,
der Leichenbrand dann darübergestreut.Die zweite Wohngrube war gleichfalls
rund und von derselben Größe wie die erste. Eine bestimmte Feuerstelle
ließ sich in ihr nicht ermitteln. Es fand sich eine Menge Scherben
größerer Gefäße, die denen der vorigen Grube völlig
glichen, aber allenthalben verstreut lagen. Ungefähr in der Mitte
der Grube lag lag umgestürzt ein wohlerhaltener Mahlstein. Daß
er in Benutzung gewesen ist, beweist die deutliche Aushöhlung.
Ferner befand sich in der Nähe des Mahlsteines ein eigenartiges
zuckerhutförmiges, gebranntes Tonstück, dessen Verwendung noch
rätselhaft ist. Seine Höhe beträgt 16 cm, der Durchmesser
seiner Bodenfläche 10 cm. Dieses Stück ist an der Spitze nicht
durchbohrt, wie ähnliche, die an anderen Orten gefunden worden sind.
Auch in dieser Grube fanden wir ein Grab. Es lag am östlichen Rande
der Grube und glich in seinem Aussehen völlig dem vorher beschriebenen.
Beim Wegräumen der Branderde stießen wir auch wieder auf Steinchen
einer Kette. Die sind aus demselben Material wie die des vorigen Grabes.
Im Gegensatz aber zu jenen waren alle beide an beiden Enden durchbohrt,
so daß sie wie Glieder einer Kette der Länge nach aneinandergereiht
werden konnten. Sieben dieser Steine, und zwar die größten,
die in der Mitte lagen, tragen außerdem an der Längsseite ein
Loch. Zu diesen gehören Steinchen, die nur einseitig durchbohrt sind
und als Anhänger an die dreifach durchbohrten Steinchen dienten.
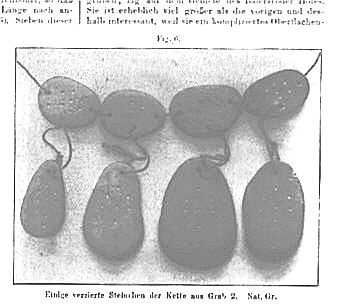 |
| Grossansicht laden | © GVW 2000 |
|
Vier der aus Grab 2 geborgenen Mainkiesel hatten nur eine Bohrung und wurden als Anhänger einer Kette bezeichnet.
Repro: Rolf Hohmann
|
Die Anhänger sowohl wie die Steinchen, an denen sie hingen, sind
durch Punktornamente recht hübsch verziert. Die Steinchen sind außer
der Durchbohrung und der Verzierung nicht weiter bearbeitet. Die Leute
haben sich diese Steinchen in dem Kiesgerölle der Flüsse zusammengesucht.
Ich habe selbst am Main, der etwa zwei bis drei Stunden von der Ausgrabungsstelle
entfernt fließt, derartige Steinchen gefunden. Doch muß man
sehr lange suchen, bis man eine zu einer Kette genügende Menge von
Form und Größe zueinander passenden Steinchen findet. Darin
mag wohl auch der Wert des Schmuckes gelegen haben. Verziert und durchbohrt
wurden die Steinchen mit Hilfe von Feuersteininstrumenten. Das gelingt
sehr leicht, wie ich mich selbst überzeugt habe. Um die Kette herum
fanden sich dann noch in dem Grabe vier Feuersteinplättchen und sechs
Scherben. Bemerkenswert ist, daß die Scherben in verschiedener Art
verziert waren. Die meisten zeigten einfache Linearverzierung, ein Stück
aber wies Stich-und Strichornamentierung nach Art des Rössen-Großgartacher
Typus auf. Das ist ein prinzipiell wichtiger Fund.
Die dritte und letzte Wohngrube, die wir ausgruben, lag auf dem Gebiet
des Baiersröder Hofes. Sie ist erheblich viel größer als
die vorigen und deshalb interessant, weil sie ein kompliziertes Oberflächenrelief
hatte. Wir haben deshalb genaue Messungen der Grube vorgenommen und mit
Hilfe eines an Ort und Stelle hergestellten Lehmmodells eine genaue Rekonstruktion
der Grube gemacht. Die Grube enthält in ihrem nördlichen Teile
größere, durch Wälle voneinander getrennte rundliche Räume.
In dem einen fand sich eine Vertiefung in der Größe und Tiefe,
wie wir sie in der ersten Wohngrube kennen gelernt haben. Diese drei Räume
mögen wohl vorwiegend als Wohnäume benutzt worden sein. In diesen
Gruben fanden wir zwei kleine Beile und ferner flache Schieferplatten,
die wohl als Amulette gedient haben. Eine derselben ist vierseitig und
doppelt durchbohrt. Diese beiden bildeten zusammen ein Gehänge. Von
zwei anderen, die aber vielleicht nicht zusammengehören, ist die eine
oval, doppelt durchbohrt, die andere ebenfalls dreiseitig an der Basis
ausgebuchtet und daselbst durchbohrt. Diese Schieferplatten sind durch
Punkte verziert.
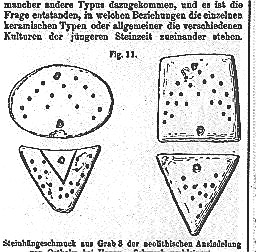 |
| Grossansicht laden | © GVW 2000 |
|
Verzierte Schieferplättchen aus Grube 3, Zeichnung von Prof. Heiderich (?)
Repro: Rolf Hohmann
|
Außerdem lagen in diesen Gruben zwei Stückchen Rötel,
die ausgeschliffen sind. Der aus ihnen hergestellte Farbstoff dürfte
wohl zum Bemalen der Haut und Geräte gedient haben. Dann fanden sich
hier noch eine Anzahl von Tierknochen, wohl Reste der Mahlzeiten der Bewohner.
Nach Süden hin schließen sich ganz unregelmäßig gestaltete
Räume an. Über deren Bedeutung sich nichts Bestimmtes sagen läßt.
Vielleicht sind hier die Schlafstellen gewesen. An zwei Stellen in der
Wohnung befanden sich kleine Hügel, die, wie die nähere Untersuchung
ergab, künstlich aufgeschüttet waren, denn sie waren von vielen
Kohlestückchen durchsetzt. In ihrer Nähe fanden sich zahlreiche
Tierknochen, die zum Teil im Feuer gewesen sind, Scherben größerer
Gefäße und zahlreiche Kohlestückchen. Man geht wohl nicht
fehl in der Annahme, daß hier die Herdstellen gewesen sind. Die Hügel
werden vielleicht für die Stäbe, an denen die Kochtöpfe
aufgehängt waren, gedient haben. Die Tierknochen stammen von Rind,
und zwar von jungen Tieren, zum Teil auch vom Hirsch; in der Ecke lag ferner
ein Stück Hirschgeweih. Auch in dieser Wohnung befand sich ein
Grab. Es lag im südlichen Teile derselben. In der Erde darüber
lagen reichverzierte Scherben, deren Ornamente mit gelber Farbe angestrichen
waren. Das Grab war von einem Erdhügel bedeckt.
Nach dessen Abräumung glich es den beiden anderen Gräbern
genau. Dieses Grab haben wir, um es in der Sitzung der Gesellschaft freilegen
zu können, uneröffnet dem Boden entnommen. Zu diesem Zecke wurde
ein an dem unteren Rande zugeschärfter Blechkranz um das Grab herum
in die Erde eingedrückt, darauf wurde das Erdreich außerhalb
des Kranzes entfernt und nun ein starkes Blech unter dem Kranze durchgeschoben
und so die in dem Kranze befindliche Erdmasse von der Unterlage abgetrennt.
Dann wurde das Grab in eine Kiste verpackt und hierher transportiert"
Soweit der Vortrag von Professor Heiderich im Wortlaut. Seine Ausführungen
werden später hinsichtlich des von Gudrun Loewe gegen Georg Bausch
erhobenen Fälschungs-Vorwurfs aus des Sicht eines Autodidakten einer
näheren Betrachtung unterzogen.
Anschließend sprach Professor Max Verworn über den "Kulturkreis
der Bandkeramik" mit besonderer Berücksichtigung der Ausgrabungen
bei Hanau und Diemarden bei Göttingen. Die für unsere Nachforschungen
relevanten Passagen seiner Ausführungen werden wir zu einem späteren
Zeitpunkt veröffentlichen. Am Schluß der Zusammenkunft des Anthropologischen
Vereins Göttingen am 31. Mai 1909 fand eine wohl außergewöhnliche
Demonstration statt: "Nach dem Vortrage wurde in der Sitzung das noch ungeöffnet
mitgebrachte Brandgrab der großen Hanauer Wohngrube geöffnet.
Es fand sich bei der auf dem Tisch vorgenommenen Ausgrabung außer
dem Leichenbrand eine einfache Kette aus unverzierten Steinchen, die von
je einem Loch durchbohrt an einer Schnur befestigt waren. Die Aushebung
des Grabes wurde von der zahlreich besuchten Versammlung mit gespannnter
Aufmerksamkeit verfolgt." |



