|
|
Gudrun Loewe fällte vernichtendes
Urteil
Hat Laie Georg Bausch alle Koryphäen getäuscht
?
Von Rolf Hohmann
| Als Professor Dr. Georg Wolff im Jahre 1929 verstarb, waren die "Wetterauer
Brandgräber" längst in vielen Fachzeitschriften und Lehrbüchern
fest verankert. Kein Prähistoriker zweifelte die Echtheit dieser außergewöhnlichen
bandkeramischen Gräber und - trotz einiger Ungereimtheiten -, wurden
auch nicht die Beigaben in Form von durchlochten Mainkieseln, Schieferplättchen,
Gefäßbruchstücken usw. als unecht angesehen.
 |
| Grossansicht laden | © GVW 2000 |
|
Aus dem Loewe-Verzeichnis aller "Wetterauer Brandgräber" mit den in ihnen anthaltenen Artefakten 1906-1910
Scan: Rolf Hohmann
|
Sollte es bei diesen Brandgräbern nicht mit rechten Dingen zugegangen
sein, so hat Georg Bausch das Geheimnis 1932 mit ins Grab genommen. Es war
dann wohl der in Marburg lehrende Professor Dr. Gero von Merhart, der Ende
der 30er Jahre zwar nicht die Echtheit der Brandgräber an sich in Frage
stellte, wohl aber die vieldiskutierten Steinketten. Hier wird immer wieder
sein Schüler Armin Stroh zitiert, der in seiner 1938 verfassten Dissertation
"Die Rössener Kultur in Südwestdeutschland" das Thema kurz streift
und ausführt: "Um die Erforschung der "Wetterauer Brandgräber" war
besonders Wolff bemüht, aus dessen Feder eine umfangreiche Literatur
zu dieser Frage herrührt. Schuchardt gibt folgende kurze Beschreibung:
"Sie markieren sich als runde schwarze Flecken, nicht größer als
eine gewöhnliche Schüssel. Umgrenzt ist das Rund von den verzierten
flachen Steinchen einer Halskette. In der Mitte liegen, mit Holzkohle gemischt,
die fast zu Asche verbrannten Knochen und einige Scherben, zur Hälfte
von Spiral-, zur Hälfte von Rössener Keramik." In einer Fußnote
merkt Stroh an: "Eine eingehende kritische Untersuchung der Kieselketten
und vor allem der "Anhänger" wäre dringend geboten. Mindestens sollten
sie, solange eine solche nicht stattgefunden hat, nicht zu irgendwelchen Schlüssen
oder Beweisführungen herangezogen werden." Der Doktorant äußerte
also einen vagen Verdacht, ohne jedoch einen direkten Fälschungsvorwurf
zu erheben.
Wesentlich eingehender befasste sich 1943 Hermann Müller-Karpe in seiner
Seminararbeit "Zur Originalitätsfrage der Wetterauer Brandgräber"
mit der Materie. Er faßt in seinem Resümee zwar viele Verdachtsmomente
zusammen, die für eine Fälschung sprechen könnten, fällte
aber kein endgültiges Urteil über eine mögliche Manipulation
der Gräber und Beigaben durch Georg Bausch.
Das blieb Gudrun Loewe vorbehalten, die in ihrer 1958 in der "Germania"
veröffentlichten Abhandlung "Zur Frage der Echtheit der jungsteinzeitlichen
"Wetterauer Brandgräber" den Stab über den Windecker Brunnenbauer
brach. Da diese vielzitierte Arbeit vom Geschichtsverein Windecken 2000 aufgrund
umfangreicher Quellenstudien und eines kürzlich aufgetauchten schriftlichen
Augenzeugenberichts von Grabfreilegungen in der Gemarkung Butterstadt im
Jahre 1907 nicht in allen Teilen widerspruchslos hingenommen werden soll,
veröffentlichen wir nachfolgend den Loewe-Text im Wortlaut.
Im jungsteinzeitlichen Fundgut Hessens bilden die "Wetterauer Brandgräber"
eine Sondergruppe; sie haben ihren Namen von G. Wolff erhalten auf Grund seiner
Funde in der südlichen Wetterau, insbesondere dem Vorland von Frankfurt
und Hanau. Meist werden sie der Bandkeramik, seltener der Rössener Kultur
zugeschrieben, entweder wegen ihrer Lage in oder bei "Wohngruben" oder wegen
eingestreuter oder beigegebener, ja sogar zu Schmuckanhängern verarbeiteter
Scherben dieser oder jener Kultur. Zu Beginn unseres Jahrhunderts galt der
"Rössen-Gartacher Stil" als eine Spielart der Bandkeramiker. Einen Beleg
hierfür und auch ein Bindeglied für die Verschmelzung von Liniearbandkeramik
mit Rössen zum "Wetterauer Stil" fand Wolff in Gestalt der Wetterauer
Brandgräber.
Die Entdeckung der Gräber war eine Sensation. Wolff schreibt darüber:
"Zum ersten Mal in ganz Westdeutschland fanden sich in Verbindung mit dieser
Keramik neben und in den durch die Unregelmäßigkeit ihrer Profile
und Grundrisse auffallenden Wohngruben (seit 1907) auch sehr unscheinbare
Brandgräber. Der Umstand, daß diese leicht übersehen werden,
erklärte es, daß dort und in anderen Gegenden mit derselben Keramik
bis dahin überhaupt keine Gräber gefunden worden waren". Der mehrfach
hinzugezogene Direktor der Römisch-Germanischen Kommission äußert:
"Es wird von höchstem Interesse sein, durch fortgesetzte
Beobachtungen festzustellen, wie weit sich diese offenbare Stammeseigentümlichkeit
räumlich erstreckt und wann innerhalb der neolithischen Periode sie auftritt."
K. Schumacher vermutet, daß "die in der Wetterau so häufigen
Brandgräber, die in dem nicht minder dicht besiedelten Rheinhessen bis
jetzt fehlen, mit der Zeit wohl auch auftauchen werden...." Allein, die
Hoffnungen auf weitere Funde von Brandgräbern dieser Art in der Wetterau
oder anderwärts gingen nicht in Erfüllung. Seit 1920 wird kein
entsprechender Grabfund mehr verzeichnet.
Nachdem nun mehr als ein Menschenalter seit der Auffindung der letzten "Wetterauer
Brandgräber" in Windecken im Apil 1920 verstrichen sind, mag man sich,
vor allem angesichts der vielen bandkeramischen und Rössener Funde,
die in der Zwischenzeit gehoben wurden, und in Anbetracht der verfeinerten
Grabungsmethoden die Frage vorlegen: Warum kamen diese Brandgräber nur
zwischen 1907 und 1920 zu Tage? Zur besseren Übersicht des umfangreichen
Fundstoffes soll die eingefügte Tabelle dienen, in der alle Brandgräber
mit Beigaben der typischen Schmuckketten oder -anhänger in der Reihenfolge
ihrer Auffindung und unter Berücksichtigung der Schmuckbeschaffenheit
verzeichnet sind. Auch Einzel- oder Siedlungsfunde solcher Schmuckstücke
fanden Aufnahme. Da Wolff kein systematisches Fundregister veröffentlicht
hat, waren nicht alle Einzelangaben mit völliger Sicherheit zu gewinnen,
zumal auch sein damals beispielhaftes Inventarwerk der südlichen Wetterau
ungleichwertige, mitunter detaillierte, oft aber nur summarische Angaben über
die Brandgräber enthält.
In einem grundlegenden Bericht von 1911 nennt Wolff für die erste große
Gräbergruppe in der Gemarkung Butterstadt (nahe der Grenze gegen Marköbel)
häufig auch Marköbel als Fundort; ähnlich verfährt er
in einigen späteren Arbeiten. An der ungleichmäßigen Berichterstattung
liegt es auch, daß nicht für alle Funde bekannt ist, wer sie geborgen
hat. In mehr als der Hälfte der Fälle wird der Vorarbeiter G. Bausch
erwähnt, der im Herbst 1906 die ersten Funde machte und als Brandgräber
deutete, ohne daß ein Wissenschaftler den Befund im Gelände gesehen
hatte. Die Beteiligung von Bausch ist, soweit ersichtlich, in die dritte Spalte
der Fundliste aufgenommen. Anfangs fanden Bauschs neuartige Funde Mißtrauen
bei Wolff, weil die Kiesel mit Tinte gefärbt waren und dem Mannheimer
Museum angeboten wurden. Später als Bausch im April 1910 mit seinem
Sohn nach Göttingen geschickt wurde, um als erfahrener Vorarbeiter bei
der großen Bandkeramikgrabung in Diemarden zu helfen, "....erregten
die besondere Aufmerksamkeit der gelehrten Welt die steinernen Schmuckanhänger,
die 11 an der Zahl, zerstreut in verschiedenen Wohngruben gefunden wurden".
Weiter schreibt B. Crome: "Die völlige Aehnlichkeit mit den von Wolff
in der Wetterau gefundenen Anhängern fiel sogleich ins Auge". Auch
Wolff stellt "die auffallende Übereinstimmung der Diemardener Anhänger
in Form, Größe und Ornamenten mit den am Rüdigheimer Judenberge
und auf dem gegenüberliegenden Tannenkopf bei Butterstadt" fest;
deshalb ist es notwendig, festzustellen, daß bei der Hebung der Diemardener
Stücke nur Bausch und sein Sohn, in keinem Falle aber ein wissenschaftlicher
Teilnehmer zugegen war (ein Stück fand Bausch schon am ersten Tage der
Grabung). "Wohl aus dieser kritischen Bemerkung Cromes, wie auch aus seiner
weiträumigen Materialkenntnis zieht W. Buttler den Schluß, "die
dort (Diemarden) gleichfalls angegebenen 8 Wetterauer Kieselanhänger
sind wahrscheinlich Wetterauer Herkunft und von dem Ausgräber Bausch
in das Fundinventar hineingeschmuggelt." Bei Crome liest man weiterhin:
"Auf einem ganz anderen Blatte steht natürlich, wenn einige Zeit nachher
Bauschs Sohn den Verfasser durch Kiesel mit rezenter Durchbohrung und Verzierung,
die er auf der "schwarzen Stelle" eines Ackers (wo im Jahre zuvor eine Dreschmaschine
gestanden hatte) umherstreute, zu täuschen versucht hat; die Stücke
der Grabung sind auf jeden Fall alte, echte Stücke."
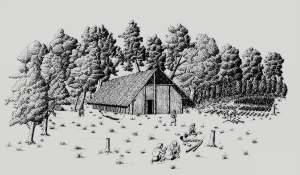 |
| Grossansicht laden | © GVW 2000 |
|
Rekonstruktion eines bandkeramischen Hauses nach G. Lanz. Aus: Der bandkeramische Siedlungplatz Langweiler 8 Gemeinde Aldenhoven (Ulrich Boelicke u.a.)
Scan: Rolf Hohmann
|
Hier steht eine erste Erkenntnis von Fälschungen neben dem Vertrauen
auf die seit 1907 eingeführten gleichartigen Funde, denn diese waren
bereits Gemeingut der Wissenschaft geworden. Namhafte Übersichtswerke
berichteten über die "Wetterauer Brandgräber" als Lokalgruppe:
G. Schwantes, Deutschlands Urgeschichte (1918, zuletzt 1952), C. Schuchardt,
Alteuropa (1918, zuletzt 1944); W. Bremer in Ebert XIV (1929) und Buttler
im Handbuch der Urgeschichte Deutschlands 2 (1938). Noch 1954 zieht H.D.
Kahlke "die Brandgräberfelder mit Linearbandkeramik des Maintals" in
Betracht trotz seiner eigenen Fußnote "Viele Prähistoriker
stellen die Echtheit der Funde in Frage" und beschreibt sie mit Zitaten
von Wolff und 0. Kunkel. Zweifel an der Echtheit der "Wetterauer Brandgräber"
scheinen hauptsächlich von der Marburger Schule G. von Merharts auszugehen:
A. Stroh hält 1940 die Gräber als solche für sicher, mißt
ihnen aber "bei den wenig eindeutigen Fundverhältnissen" keine
Bedeutung für das Verhältnis der Rössener zur Spiralbandkeramik
bei. 1943 widmet H. Müller-Karpe eine leider schwer zugängliche
Seminararbeit der Frage nach der Originalität der "Wetterauer Brandgräber".
Daß ihm ein klares Ergebnis versagt bleibt, hat wohl mehrere Gründe:
Einmal faßt er den Bereich seiner Nachforschungen zu eng und behandelt
nur die ins Museum Hanau gelangten Funde vor 1910, zweitens ist seine Fragestellung
allzu stark an die Person Bauschs geknüpft, und schließlich fehlte
es ihm wohl damals an Grabungserfahrung, um Wolff Tagebuch kritisch lesen
und ausschöpfen zu können. Schon Stroh erwähnt, daß die
Brandgräber lediglich in Wolffs Arbeitsgebiet zu Tage kamen. Tatsächlich
gibt ihre Verbreitung weder das Bild einer geographischen noch einer kulturellen
Einheit wieder, sondern eher eine Statistik, wo Wolff überall tätig
war, beziehungsweise seinen Mitarbeiter Bausch eingesetzt hat. Die Auffindung
der "Wetterauer Brandgräber" ist zeitlich und örtlich mit diesen
beiden Männern verknüpft.
Die "Verbreitung" geht nur in einigen Punkten über Wolffs eigentliches
Arbeitsgebiet, die südliche Wetterau, hinaus, nämlich in Muschenheim.
Kr. Gießen und Beltershausen (Frauenberg), Kr. Marburg. Und beide Male
ist Wolff der Ausgräber und berichtet für die Frauenberggrabung
auch von Bauschs wertvoller Mitarbeit. Darüber hinaus ließen sich
die von Wolff 1917 aufgezählten "neolithischen Scherben und mehrere
der für die bandkeramische Kultur der Wetterau charakteristischen Anhänger
und rohen Perlen aus Beltershausen-Frauenberg, Ebsdorf, Ronhausen, Bortshausen
im Ebsdorfer Grund und aus Schröck, Kr. Marburg, 1929 nicht mehr nachweisen,
und Buttler schreibt dazu: "Die übrigen von Wolff als Bandkeramik
bezeichneten Fudstellen im Ebsdorfer Grund....weisen nur rohe, unverzierte
Scherben auf, die jeder Zeitstufe angehören können." Tonperlen
und Scherbenanhänger gelten Buttler eben nicht wie Wolff als Charakteristika
der Bandkeramik. Der ganz abseits liegende, in der Fundliste nicht genannte
Fundort Diemarden, Kr. Göttingen, wurde oben schon als mit Bausch zusammenhängend
erwähnt.
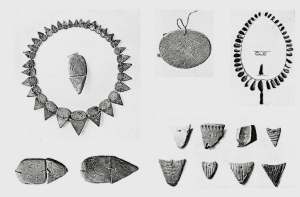 |
| Grossansicht laden | © GVW 2000 |
|
Beigaben aus Bausch-Gräbern. Links oben Kette aus Schieferanhängern (Windecken), rechts oben Kette aus Kieselsteinen (Marköbel) sowie
Einzelanhänger aus den Gemarkungen Ostheim, Rüdigheim und Windecken. Bearbeitet von Dr. Ferdinand Kutsch 1926
Scan: Rolf Hohmann
|
Aufschlußreich will es scheinen, daß die Gräberfunde der
ersten Fundjahre mehr in der Hanauer Gegend - Bausch war in Windecken zu
Hause und arbeitete je nach Bedarf für die Römisch-Germanische
Kommission und den Hanauer Geschichtsverein in der südlichen Wetterau
- häufen und späterhin, als Bausch Vorarbeiter des Historischen
Museums Frankfurt war, auch öfter im Frankfurter Raum auftreten. Zudem
fällt auf, daß den anfangs sehr reich mit Schmuck ausgestatteten
Gräbern später recht ärmliche folgen, und daneben Einzelfunde
von entsprechenden Stein- und Knochenschmuckstücken sowie Tonperlen
in Siedlungen die Fundorte vermehren. Das Aufsehen, das die "Wetterauer Brandgräber"
in der Wissenschaft erregten, galt ebensosehr der bis dahin für das
Neolithikum kaum bekannten Brandbestattung wie den völlig neuartigen
Grabbeigaben von Hängeschmuck. Letztere zeigen in der Reihenfolge der
Auffindung eine merkwürdige Entwicklung von Kieseln zu Schieferplättchen
und diesen ähnlich zugeschnittenen verzierten Gefäßscherben
und schließlich zu Perlen aus gebranntem Ton und Knochenanhängern
verschiedenster Form.
Kiesel- und Schieferanhänger müssen 1910/11 aus der Mode gekomen
sein und tauchen nur gegen Ende der "Fundperiode" nochmals vereinzelt auf.
Ungeahnte technische Fähigkeiten der Steinzeitmenschen schienen sich
in den feinen Durchbohrungen und Verzierungen anzudeuten. Wolff setzt ohne
Bedenken voraus, daß die oft weniger als 1 mm und bis zu 5 mm langen
zylindrischen, anscheinend meist von beiden Seiten her geführten Bohrungen
mit dem Silexbohrer ausgeführt worden seien; nur R. Welcker bewegt staunend
"die Frage nach der Technik dieser geradezu minutiösen
Bearbeitung des Steines". Die Vermutung, daß die feinen Bohrungen
und Punktverzierungen, wie auch die bei einigen Kieseln umlaufenden Halsrillen,
nur mit einem neuzeitlichen Stahlbohrer hergestellt sein können, bewog
mich, eine Anzahl Kiesel- und Schieferanhänger der Materialprüfungsanstalt
der Technischen Hochschule Darmstadt vorzulegen.
Das Gutachten vom 2.11.1954 lautet: "Zur Beurteilung von Bohrlöchern
wurden verschiedene Kiesel und Schieferplättchen vorgelegt. Die Steine
wurden zerschnitten und der Kanal durch Abschleifen vorsichtig freigelegt.
Die Bohrungen sind auffallend fein und besonders bei einem Kiesel zylindrisch
durchgehend. Die Enden des Bohrkanals sind an diesem Kiesel, im Gegensatz
zu anderen Stücken, nicht konisch erweitert. Das Erscheinungsbild ist
an diesem Kiesel entsprechend einer heutigen Bohrstelle. Auch mit dem Mikroskop
ließen sich keine abgesetzten Rillen in der Wandung beobachten, die
auf ein etappenweises Arbeiten schließen ließen. Die Dicke der
Bohrung betrug 0,95 mm, die Breite des Kieselsteines an der Bohrstelle 2,67
mm. Es kann gesagt werden, daß die Bohrung besonders an diesem Stück
durchaus den mit neuzeitlichen Geräten hergestellten Bohrlöchern
entspricht und sich stark von den abgesetzten und an den Enden konisch ausgeweiteten
Bohrungen der Steinzeit unterscheiden. Gez. Gerhard Schultz Diplom-Chemiker"
Der hier eingehend besprochene Kiesel stammt aus Butterstadt, Grab 34 (Museum
Hanau). Zur Erprobung des Arbeitsvorganges habe ich selbst mit der biegsamen
Welle eines Elektromotors zwei Löcher beiderseits der "Originalbohrung"
eines Schieferanhängers von Büdesheim gebohrt und den Rand des
Stückes bis zu diesen drei Löchern weggeschliffen. Das Ergebnis
zeigt Abb.1: Die linke Bohrung ist in einem Zuge von unten her durchgeführt;
beim Durchstoßen des Bohrers sprang oben ein kleines rundes Plättchen
weg. Die mittlere Bohrung ist "original" und noch etwas verschmutzt. Die
rechte Bohrung war meine erster Versuch; sie wurde von oben begonnen, dabei
kam mein Bohrer ins Schleudern, weil ich nicht rechtzeitig das feine Bohrmehl
des Tonschiefers ausblies; dann vollendete ich die Bohrung von der Gegenseite.
Wenn Wolff schreibt, "Diese Durchbohrungen sind....von beiden Seiten ausgeführt,
da sie von einem engen Teil in der Mitte sich nach beiden Außenseiten
ein wenig verbreitern," so hat er sicherlich Bohrungen wie Abb. 1, rechts
beobachtet. Doch ist eine so geringe Abweichung von der Zylinderform etwas
grundsätzlich Anderes als die für neolithische Kleinbohrungen in
Stein und Knochen bezeichnende doppelkonische (=sanduhrförmige) Form
des Bohrkanals, dessen schmalste Stelle nahe der Mitte des Stückes in
der Regel wenigstens 2 mm mißt, während die Öffnungen an den
Oberflächen etwa doppelt so weit sind.
Ebenso fein und zylindrisch wie bei den Steinanhängern sind häufig
die Durchbohrungen der seit 1910 hin und wieder auftretenden aus verzierten
Scherben geschnittenen und der Knochenanhänger, sowie bei Tierzähnen
aus "Wetterauer Brandgräbern". Die harten Umrisse, insbesondere die
konkave Oberseite und die scharfen Kanten der 1908-1910 gefundenen Schieferanhänger
weichen von der neolithischen Gestaltungsweise ab und verraten viel geringeres
Formgefühl als die werkgerechten neolithischen Steingeräte. Gewiß
war der weiche Heldenbergener Schiefer leichter zu bearbeiten, doch würde
ein Steinzeitmensch die Aufgabe sicherlich anders, harmonischer gelöst
haben. Die Beobachtung, daß zwei Kilianstädter und ein Büdesheimer
Anhänger "aus dem platten blauschwarzen Schiefer unserer Kinderschreibtafeln"
bestehen, hat Wolff keinesfalls beunruhigt.
Wir müssen heute aber fragen: Wo konnten die Steinzeitler in der Wettau
solchen Schiefer finden? Oder wann mag das Material für die drei Stücke
ins Land gelangt und hier verarbeitet worden sein? Zu den weniger häufigen
Beigaben zählen neben den aus verzierten Tonscherben geschnittenen seit
1911 solche aus Knochen. Ihre Form wechselt von zugespitzten Tierzahnimitationen
über Rund- und Dreieckscheibchen zu länglichen Zungen mit Schnittverzierung
und einmal in einem in groben Zügen modellierten Fisch. Im Gegensatz
zu allen anderen Beigabentypen, die keinerlei Brandspuren aufweisen, sind
die Knochenanhänger dem Leichenbrand sehr ähnlich und haben großenteils
zweifelslos Hitzeeinwirkung erlitten. Sie haben, abweichend von den scharfkantigen
Formen der Schiefer, weiche Konturen, dazu mitunter feine Risse in ihrer
weißlichen, mehligen Oberfläche. Eine besonders häufig in
der Frankfurter Gegend vorkommende Beigaben-Gattung der "Wetterauer Brandgräber"
besteht aus Tonperlen verschiedener Art und Größe.
In Frankfurt-Berkersheim sind es rundliche Tonscheiben in der Stärke
von Gefäßscherben, deren Peripherie viermal eingekerbt ist, so
daß der Gesamtumriß einem Vierklee nahekommt; eine ähnliche
Vierteilug entsteht durch flache Rillen auf doppelkonischen und rundlichen
Perlen von demselben Fundort. Viele andere Tonperlen werden "spinnwirtelförmig"
genannt und gleichen in der Tat plumpen Spinnwirteln bis auf die Öffnung;
diese reicht bei den "Perlen" stets nur für die Aufnahme eines Fadens
aus, nicht aber für eine Spindel aus Holz oder Knochen. Nachdem mehrmals
solche Tonperlen in "Wetterauer Brandgräbern" und in bandkeramischen
oder Rössener Siedlungsgruben gefunden worden waren, genügte Wolff
ihr Vorkommen als Leitfossil für Bandkeramik (oder Rössen). Anderwärts
sucht man vergebens nach Vorkommen derartiger Tonperlen bei Bandkeramik,
und Buttler berichtet von ihnen ausdrücklich nur für Oberhessen.
Die Tonperlen sind also durch die "Wetterauer Brandgräber" aufgekommen
und ausschließlich in den Jahren 1911-1920 gefunden worden. Sie gehören
zusammen mit den Beigaben von Kiesel-, Schiefer-, Scherben- und Knochenanhängern
zu dem fragwürdigen Komplex der "Wetterauer Brandgräber".
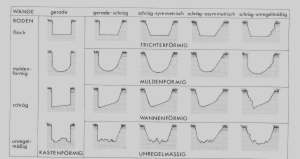 |
| Grossansicht laden | © GVW 2000 |
|
Schema zur formalen Klassifikation der Profile bandkeramischer Gruben. Aus: Der bandkeramische Siedlungsplatz Langweiler 8 Gemeinde Aldenhoven (Ulriche Boelicke u.a.)
Scan: Rolf Hohmann
|
Etwa hundert Brandgräber sind insgeamt gefunden worden. Für eine
Anzahl von ihnen liegen Beschreibungen der Ausgrabung vor. Viele Wissenschaftler
sind Zeugen solcher Ausgrabungen geworden, weil die bis dahin unbekannte
Grabform größtes Interesse weckte, und die relativ kleinen Objekte
sich gut, auch mehrere an einem Tag, in einer Schaugrabung vorführen
ließen. Die Beschreibungen gleichen sich weitgehend. Lediglich die
Tiefe ist sehr unterschiedlich, weil die Gräber stets, ob in ungestörtem
oder Siedlungsboden, um etwa 10 cm in den gewachsenen Boden eingetieft waren.
Ganz zu unterst, gerade noch in der dunklen Einfüllung, zeigten sich,
stets mit Sorgfalt deponiert, die bis auf die Knochenanhänger ungebrannten
Beigaben. Im Kranz der Beigaben und locker in der Füllerde fand sich
der Lei- chenbrand, gewöhnlich nur soviel, wie auf einen Löffel
geht. In einigen Fällen lagen datierte Scherben um die Beigaben gruppiert
oder in der Füllerde. In vorgeschichtlicher Zeit dominierte die Sitte,
die Beigaben auf den in größerer Menge beigesetzten Leichenbrand
zu legen.
Die Menge des in Arnstadt unter einer umgestülpten bandkeramischen Schale
beigesetzten Brandes benennt G. Neumann mit 295 g. Flüchtige Streuungen
kleiner und kleinster Mengen von Leichenbrand sind mir nur aus römischen
Brandgräbern bekannt. Wolff berichtet mehrfach, daß Bausch auch
römische und laténezeitliche Brandgräber geborgen hat. Als
Beispiel sei angeführt, daß Bausch vor Öffnung des Grabes
8 von Butterstadt drei Tage lang in der Nachbargemeinde Marköbel römische
Brandgräber ausgegraben und auch vor den Gräbern 37 und 38 wiederum
fünfundzwanzig solcher Gräber gefunden hat. Wolffs ausdrückliche
Anweisung, gefundene Brandgräber in situ zu belassen, damit ein Wissenschaftler
das Ausnehmen beaufsichtigen könne, hat Bausch wieder und wieder übertreten
und Grabinhalte abgeliefert oder durch seine Frau überbringen lassen.
Offensichtlich wurde diese Praxis auch bei anderen Vorgeschichtsfunden geübt
und war während Bauschs langjährige Mitarbeit zur Gewohnheit geworden.
Bezeichnend für Bauschs Arbeitsverhältnis und Persönlichkeit
sind folgende Worte Wolffs: "Die ersten Brandgräber wurden im Herbst
1906 von dem Brunnenbohrer Georg Bausch aus Windecken gefunden, der mir bei
der Erforschung des römischen Straßensystems für die Reichs-Limeskommission
durch seine Findigkeit und Lokalkenntnis gute Dienste geleistet hatte. Außerdem
hatte ich in den drei Jahren (zu den Untersuchungen bei Marburg) den Vorarbeiter
G. Bausch vom Frankfurter Museum mitgebracht, der mir während der letzten
15 Jahre vor dem Kriege im Aufsuchen von Spuren römischer und prähistorischer
Siedelungen auf den weiten Lößflächen der Südwetterau
gute Dienste geleistet und in der sorgfältigen Ausschälung neolithischer
Wohngruben und Brandgräber sich eine seltene Sicherheit angeeignet hatte."
Bauschs Hilfe war begehrt; so schreibt Welcker vom Frankfurter Osthafen, "daß
wir über den Vorarbeiter Bausch, einen besonders glücklichen Finder,
verfügen konnten, war für unsere Untersuchungen schon aus dem Grunde
von großem Vorteil, als dieser mit bemerkenswertem Spürsinn ausgestattete
Mann bei den Arbeiten des Archäologischen Instituts an der Hohen Straße
von Anfang an den Forschern die besten Dienste geleistet hat und mit den
in Frage kommenden Funden und Fundumständen auf das Genaueste bekannt
ist." Ja, selbst die Göttinger Wissenschaftler M. Verworn und F.K. Heiderich,
die Bauschs Mitarbeit 1909 bei Butterstadt und Baierröder Hof schätzen
gelernt hatten, wollten sich auch in der großen bandkeramischen Siedlung
Diemarden bei Göttingen 1910 seine Findigkeit zu Nutze machen: "Zugleich
wurde der Brunnenbohrer Bausch aus Windecken bei Hanau, der schon bei der
Aufdeckung der Brandgräber in der Wetterau wertvolle Dienste geleistet
hatte, für die Zeit von vier Wochen in Anspruch genommen."
Trotz Bauschs Anwesenheit wurden aber die erhofften Brandgräber nicht
gefunden, sondern nur die oben behandelten 11 (oder 8) Kiesel- und Schieferanhänger
verstreut in den Siedlungsgruben. Zur Kennzeichnung der Arbeitsweise bei
der Bergung und der Beschaffenheit der Gruben ist Folgendes zu berichten:
Im Herbst 1907 schreibt der Assistent der Römisch-Germanischen Kommission
P. Steiner im Grabungstagebuch über Grab 7 von Butterstadt, das den
ersten klaren Befund ergab: "Oben, auf halber Höhe des Feldes, wo
Bausch seine letzten Halsketten fand, mußte er graben. Er geriet
dabei in immer größere Erregung und schließlich hob sich
wirklich in dem hellgelben und lederbraun durchsetzten (gefleckten) Lehmboden
ein eiförmiger schwarzer Fleck ganz deutlich ab und es kamen sofort
Knochenreste und schwarze Scherben und - gar nicht lange dauerte es - auch
wirklich wieder jene Kieselsteinchen zum Vorschein; das ganze Grab wurde
dann von mir sorgfältig mit dem Messer ausgekratzt (Man übersieht
die Flachkiesel außerordentlich leicht!) und ich hatte den Eindruck,
ein Brandgrab unter den Händen zu haben." Zu Grab 9 schreibt Steiner:
"An einer Stelle des Schnittes, die Bausch schon aufgegeben
hatte, scheint mir etwas verdächtig, und ich gebe Bausch Anweisung,
weiterzugraben." Dann machte sich die Einfüllung bemerkbar: "Ich
sah sie zuerst, während Bausch fühlte, daß in der Mitte der
Boden lockerer war." Bald darauf zeigten sich wiederum die Kettenkiesel.
Für Grab 20 gab Bausch im März eine Stelle an, an der "ein Grab
eingekreist, aber nicht ausgenommen zu haben erklärte". Im April
wurden Grab 23 bis 28 ausgegraben, die alle vorher von Bausch entdeckt worden
waren. Zu Grab 24 bemerkt Steiner: "Die Füllung war wie gute Gartenerde".
Heiderich berichtet zu Grab 35: "Der Vorarbeiter Bausch hatte bereits
zwei Stellen für die Grabung vorbereitet und Versuchsgräben angelegt.
Bei der Vertiefung des ersten Versuchsgrabens schon stießen wir auf
ein Brandgrab". Die Gräber 37 und und 38 hatte Bausch bis 0,60 bzw.
0,52 cm Tiefe freigelegt, wo sich jeweils der tiefschwarze, kreisrunde Fleck
abzeichnete. Im August 1910 ließ Wolff bei Rüdigheim die Wohngrube
1, "in der Bausch Spuren eines Brandgrabes erkannt zu haben glaubt in
(seiner) Gegenwart vollständig ausgraben. Alle Gegenstände sind
in meiner Anwesenheit z.T. von mir eigenhändig erhoben worden".
 |
| Grossansicht laden | © GVW 2000 |
|
Die zwischen Marköbel und Butterstadt entlang der "Hohen Straße" bis 1912 entdeckten vorgeschichtlichen und römischen Gräber. Aus der von
Georg Wolff bearbeiteten archäologischen Fundkarte.
Scan: Rolf Hohmann
|
Mit dieser Bemerkung will Wolff die einwandfreie Bergung bekräfigen;
er gibt aber damit auch beiläufig zu, daß beides, seine ständige
Anwesenheit und eigenhändige Betätigung (er war damals 65 Jahre
alt), nicht die Regel waren. In der zusammenfassenden Beschreibung betont
Wolff die "vollkommene Gleichheit der Gräber in Form und Größe"
und die große Übereinstimmung der Art wie sie zuerst in Erscheinung
treten. Der "fettig weiche" Inhalt der Grabmulden hob sich "speckartig
tiefschwarz" ab und war "so lettenartig zusammenhängend, daß
man ihn mit einer großen Schippe unterstechen und herausnehmen konnte,
ohne daß er zerbröckelte". Dieses kann man sich ohne weiteres vorstellen,
wenn man das Situationsfoto von Ostheim betrachtet (Taf.55), das in voller
Deutlichkeit den Unterschied zwischen der dunklen, lockeren Grabfüllung
und dem helleren, homogenen, mit dem Spaten säuberlich abgestochenen
Löß der Umgebung zeigt. Der Übergang zeichnet sich am besten
an der rechten oberen Begrenzung ab als eine gebrochene Linie zwischen zwei
verschiedenen Strukturen, während der Farbunterschied nur wenig zur
Geltung kommt.
Hier besteht offensichtlich keine durch Jahrtausende dauernde Lagerung gefestigte
Verbindung zwischen dem anstehenden Löß und der humosen Einfüllung,
die ein Ausheben der Grabfüllung nach Wolffs Beschreibung unmöglich
gemacht hätte. Alte Kulturschichten pflegen sich durch besondere Festigkeit
auszuzeichnen, die durch eingeschlossene Brandreste nur noch gesteigert wird,
und sind mit dem sie umgebenden Boden fest verbunden. Die Abbildung des Brandgrabes
von Ostheim gibt das typische Bild einer neuzeitlichen Störung, die
wahrscheinlich ebenso jung ist, wie die etwa 1 mm feinen Durchbohrungen der
Kieselbeigaben dieses Grabes. Bei der Freilegung des Butterstädter Grabes
9 beobachtete Wolff eine junge Störung, die er den vor der Jahrhundertwende
hier abgehaltenen Kaisermanövern zuschrieb; ihre Einfüllung war
weicher und dunkler gefärbt als die der Wohngrube.
Andere rechteckige Gruben gleicher Größe zeigten sich mehrmals
kurz vor Entdeckung von "Brandgräbern", die in deren Boden eingetieft
erschienen. "Die Hersteller des Grabes hatten, sei es, um bequemer arbeiten
zu können, oder sei es unter dem Einflusse einer auf die ehemalige Sitte
der Körperbestattung zurückgehende Traditon, zunächst eine
für eine unverbrannte Leiche, wenigstens für einen Hocker genügende
Gruft mit fast senkrechten Wänden gegraben und dann das Brandgrab in
sie hineingebettet". Mag man die rechteckigen Gruben so oder so deuten,
im Falle Windecken 1908/09 hielt die Anschauung von dem Bestattungsgrab,
aus dem Bausch einen reichen Schieferschmuck unter einem ausgehöhlten
Stein meldete, nicht stand, denn das "Bestattungsgrab" entpuppte sich als
Wildfanggrube, die ihrer Form nach ebenfalls nicht neolithisch sondern sehr
viel jünger sein muß. In derselben Bandkeramiksiedlung von Windecken
legte P. Helmke 1920 jenes bedeutsame Grab 2 frei, das Kunkel abbildet, und
in dem nach langjährigem Ausbleiben von Kiesel- und Schieferfunden eine
Tonperle in Gemeinschaft mit einer Kieselkette und eines Schieferanhängers
begegnet; auch Grab 1 enthielt Tonperlen zusammen mit einer Kieselkette.
Einmalig ist der Befund von Grab 2 in bezug auf die Pfostenstellungen nach
Art der Siedlungsgruben am Frauenberg bei Beltershausen. Allein die Forderung
Helmkes "Die weitere Beobachtung derartiger Grabanlagen ist unbedingt
nötig" blieb ohne Widerhall; die beiden Windecker Gräber waren
die letzten überhaupt. Die Situation der "Wetterauer Brandgräber"
erscheint uns heute in einem anderen Licht als den Forschern zur Zeit ihrer
Auffindung, weil sich die Vorgeschichtsforschung seit etwa 15 Jahren zu der
Erkenntnis durchgerungen hat, daß alle früher als "Wohngruben"
bezeichneten unregelmäßigen Gruben niemals zum Wohnen gedient
haben, sondern durch Lehmentnahme zum Bestreichen der Wände benachbarter,
rechteckiger Großhäuser entstanden und in der Folge allmählich
mit Abfällen zugefüllt worden sind.
Bestattungen in Abfallgruben aber sind seltene Ausnahmen, und die sorgfältige
Ausstattung der "Wetterauer Brandgräber" mit oft reichem Steinschmuck
sticht auffällig von der banalen Umgebung ab. Als Regel für die
bandkeramische und Rössener Kultur hat Körperbestattung in Hockerlage
zu gelten, die zu Wolffs Zeit schon mit drei Gräbern in Leihgestern,
Kr. Gießen, belegt war und seither in noch mehreren Beispielen für
unsere Gegend Bestätigung fand.
Allerdings wurde nie und nirgendwo eine so überwältigende Zahl
von Funden erreicht, wie sie die südliche Wetterau an Brandgräbern
in den Jahren 1907-1910 (70 Gräber) und noch weiter bis 1920 hervorgebracht
hat. Die große Zahl der Brandgräber gab den aus ihren Befunden
gezogenen Schlüssen besonders Gewicht und verschaffte ihnen auf sensationelle
Weise Geltung, obwohl sie weder mit sonstigen neolithischen Funden noch mit
den Ergebnissen der Nachbarlandschaften harmonieren. Wie stark die Grabfunde
zu überzeugen vermochten, ersehen wir aus dem Rückschluß,
den Verworn zieht, nachdem er nur drei Gräber bei Butterstadt und Baiersröder
Hof geöffnet hat. Zwei der Gräber fanden sich in je einer Siedlungsgrube
mit Bandkeramik und eines in einer solchen mit Rössener Keramik; alle
drei enthielten Kiesel- und Schieferanhänger. Verworn findet die darauf
erstellte Gleichung Bandkeramik = Steinschmuck = Rössen, also Bandkeramik
gleichzeitig mit Rössen bestätigt duch den Fund einer Rössener
Scherbe neben fünf bandkeramischen in Grab 1 (=Butterstadt Grab 35).
Nicht nur in bandkeramischen oder Rössener Siedlungen fanden sich "Wetterauer
Brandgräber" oder ihre Leitfossilien sondern auch in Anlagen der Megalithkultur.
Die Steingruppen von Eichen und Windecken geben zwar keinerlei Anhalt für
ihre Zuordnung zu einem bekannten Megalithtyp, doch zeigt Wolff sich in zahlreichen
Erwähnungen von ihrem Grabcharakter überzeugt. Seine Nachgrabungen
ergaben keine datierenden Funde der Megalithik; am Einsiedler bei Windecken
kam eine bandkeramische Scherbe vor und einige metallzeitliche, im Herrenwald
bei einer ähnlichen Anlage nur rohe, nicht näher zu bestimmende,
vorgeschichtliche Scherben.
Eine Gruppe großer Quarzitblöcke im benachbarten Eichener Wald,
die gleichfalls von Wolff als Megalithanlage angesprochen wurde, barg in
gewissen Nischen, die durch kleine Steine begrenzt waren, muldenförmige
Brandgräber, zwei davon mit Knochenanhängern ausgestattet. Von
bemerkenswerter Einmaligkeit dürften auch die allerdings sehr flachen
Grabhügel mit "Wetterauer Brandgräbern" sein, die Wolff im Eichener
Wald zwischen Hallstatthügelgräbern fand.
Hochbetagt äußert Wolff in einer seine Erfahrungen zusammenfassenden
methodischen Publikation: "So ist die erste Entdeckung von Brandgräbern
und Wohngruben der bandkeramischen Kultur der jüngeren Steinzeit in dem
Gebiete zwischen dem Untermain und der Weser dem Scharfblick und der Lokalkenntnis
unseres Vorarbeiters Bausch aus Windecken zu verdanken."
Dabei übersieht Wolff folgende Siedlungsgrabungen seiner Zeit in eben
diesem Gebiet: 1899/1901 Niederurff, Kr. Fritzlar-Homberg (Ausgräber:
Von Gilsa, Eisentraut); 1900 Ostheim, Kr. Friedberg (Gundermann, Kornemann,
Kramer); 1902/03 Friedberg, Pfingstweide (Helmke); 1903 Friedberg, Schwalheimer
Hohl (Helmke), 1908 Leihgestern, Kr. Gießen (Kramer); 1911 Niedervellmar,
Kr. Kassel (Hofmeister); 1911/12 Eberstadt, Kr. Gießen (Bremer); Emsdorf,
Kr. Marburg (Bremer), und die Tatsache, daß sie nicht ein einziges Brandgrab
erbracht haben. Völlig klar aber wird durch Wolff hier abschließend
Bauschs Schlüsselstellung zu den Funden bestätigt.
Die in diesem Bericht vorgetragenen Bedenken haben mich zu der Überzeugung
gebracht, daß die "Wetterauer Brandgräber" nebst ihren Beigaben
von Bauschs Hand herrühren. Folgende Hauptargumente gaben dafür
den Ausschlag:
1. Die kulturelle Zugehörigkeit - Bandkeramik-Rössen-Megalith -
ist dem damaligen Stand der Kenntnis angepaßt und hält den neueren
Erkenntnissen nicht stand.
2. Die Auffindung ist persönlich und zeitlich gebunden; mithin kann
der Verbreitung keinerlei Wert beigemessen werden.
3. Die Herstellung der Beigaben wäre mit den technischen Mitteln der
Steinzeit undurchführbar; es bedarf dazu eines neuzeitlichen Metallbohrers.
4. Die relativ wenigen Grabungsbefunde und- berichte lassen die stereotypen
Grabmulden als neuzeitliche Störungen erkennen."
Soweit die nur unwesentlich gekürzte Abhandlung von Gudrun Loewe.
Nach der 1958 in der "Germania" (Korrespondenzblatt der Römisch-Germanischen
Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts) erfolgten Veröffentlichung
protestierten die Bausch-Enkel heftig gegen den erhobenen Vorwurf, ihr Großvater
sei ein Fälscher gewesen. Sie kritisierten, daß die Verfasserin
des Beitrags es, im Gegensatz zu Müller-Karpe, unterlassen habe, Zeitzeugen
zu befragen.
So lebte damals noch Johannes Kurz (Windecken), der oft als Bausch-Gehilfe
bei den Ausgrabungen im nördlichen Hanauer Kreisgebiet tätig war.
Welches Motiv hätte weiter den Brunnenbauer Georg Bausch dazu veranlassen
können, in ebenso zeitraubender wie mühevoller Arbeit hunderte
von Kieselsteinen, wahrscheinlich am Mainufer zusammenzuklauben, zu durchbohren
und mit Verzierungen zu versehen? Waren es materielle Gründe oder reine
Geltungssucht? Diese wichtige Frage stellt Gudrun Loewe nicht.
Der Geschichtsverein Windecken 2000 kann sie nach so langer Zeit wohl auch
nicht beantworten. Er wird sich aber mit der Arbeit von Gudrun Loewe und viele
ihrer, nur auf Indizien gestützten Behauptungen, in mehreren Beiträgen
auf seiner Website intensiv auseinandersetzen. Vielleicht erscheint dann der
"Meisterfälscher" Georg Bausch in einem anderen Licht.
Wir hätten Frau Dr. Gudrun Loewe gerne viele Fragen gestellt und haben
versucht, ihren Aufenthaltsort ausfindig zu machen. Als von den angeschriebenen
Stellen nur Negativbescheid kamen, haben wir die Abteilung für Archäologie
und Paläontologie im Landesamt für Denkmalpflege Hessen um weitere
Nachforschungen gebeten. Diese Aufgabe hat dankenswerter Weise Bezirksarchäologe
Dr. Guntram Schwitalla übernommen. Nachdem zunächst auch seine Anfragen
keinen Erfolg erbrachten, erhielt er auf sein Schreiben an das Einwohnermeldamt
Bäk im Amt Ratzeburger-Land am 30. Juli 2002 die handschriftliche Kurzmitteilung:
"Frau Loewe ist am 18.02.94 verstorben."
Der Versuch des Geschichtsvereins Windecken 2000 den Nachlaß der Verstorbenen
einzusehen, blieb erfolglos. Auf eine entsprechende Anfrage teilte uns der
Vorsteher des Amtes Ratzeburg-Land am 22. August 2002 mit, daß im Melderegister
keine Daten gespeichert sind und es daher nicht möglich sei, "Ihnen
von dieser Stelle eine Auskunft über einen evtl. Erben bzw. eine sonstige
Kontaktperson der Erben von Frau Dr. Loewe mitzuteilen."
In den zahlreichen hinterlassenen Schriften des Windecker Mechanikermeisters
Friedrich (Friedel) Kurz (1888-1971), ein angesehener und vielbelesener Windecker
Bürger und Bruder des genannten Johannes, befindet sich ein undatierter
handschriftlicher Entwurf, wahrscheinlich für einen Leserbrief, der offensichtlich
nach Bekanntwerden des Fälscher-Vorwurfs von Gudrun Loewe verfasst wurde.
Wir wollen den Besuchern unserer Homepage diese vehemente "Verteidigungsschrift"
für Georg Bausch nicht vorenthalten:
 |
| Grossansicht laden | © GVW 2000 |
|
Mechanikermeister Friedel Kurz im Jahr 1970 vor seinem Hochrad im Heimatmusem Windecken, das sich früher im Erdgeschoss des 1520 erbauten Rathauses befand.
Scan: Rolf Hohmann
|
"Georg Bausch aus Windecken ist tot, der kann den Verleumdern
nicht die rechte Antwort geben. Aber es leben noch Leute, die ihm bei den
Ausgrabungen geholfen haben. Bausch war ein Mann der es verdient, von der
Forschung als außergewöhnlicher Kopf bezeichnet zu werden. Zum
Verständnis dafür, daß man ihm bitterstes Unrecht tut, muß
man über die Arbeitsweise, wie er die vielen Gräber, Wohngruben
usw. entdeckte, Bescheid wissen. Im Winter, wenn nach Regen oder nachdem
der Schnee abgetaut war, die freien Landflächen begangen wurden, stellte
Bausch mit unfehlbarer Sicherheit fest, wo zu graben war, um historische
Funde zu bergen. Nie geschah es, daß er zu graben begann, ohne daß
Professor Wolff oder Steinert dabei waren. Jedermann, der ihn kannte, weiß,
daß er es nicht nötig hatte, die Gegenstände, die er in unzähligen
Mengen aus der Erde holte, zu fälschen. Keiner freute sich mehr als
er über den Erfolg seines Scharfsinnes, der ohnegleichen war. Was die
Wissenschaftler, die mit ihm zu tun hatten, stets anerkennen mußten.
Es wurden hier Brandgräber ausgegraben, die Jahrtausende unberührt
geblieben waren und zwar unter persönlicher Aufsicht von Professor Wolff.
Dafür sind Zeugen da, mehr als genug. Es darf doch kein vernünftiger
Mensch glauben, daß die tausende Funde, die Bausch ans Tageslicht brachte,
gefälscht sein könnten. Der Bausch war ein ehrlicher Kerl, der
eine sehr zahlreiche Familie zu ernähren hatte und stets in sehr kleinen
Wohnungen hauste. Zum Fälschen hatte er daheim wirklich keine Gelegenheit.
Kein Mensch, der seine Verhältnisse und seine Art kannte, glaubt, daß
er es fertig brachte, aus Gewinnsucht zum Fälscher zu werden. Er war
ein Idealist und hatte die seltene Gabe, jede kleine Scherbe, jedes Kohlebröcklein
im Gelände schon vom bloßesten Sehen auf sein Alter abzuschätzen.
Daß die Brandgräber unter Aufsicht von Experten auf diesem Gebiet
ausgehoben wurden, dafür sind noch Zeugen am Leben. Man macht sichs sehr
leicht, von Fälschungen durch Bausch zu sprechen. Wie wäre es aber,
wenn die Sachen, die Bausch ausgrub, echt wären und die heute im Museum
befindlichen gefälscht sind? Daß man eben selten einen Menschen
findet, der wie Georg Bausch überall im Gelände etwas fand,
was vorher kein Mensch ahnen konnte. Hatte Bausch eine Stelle gefunden, die
ihm das Vorhandensein einer Wohngrube, eines Grabes oder einer historischen
Stätte überhaupt anzeigte, so meldete er das Professor Wolff oder
Steiner. Dann mußte der Besitzer des Grundstückes um Erlaubnis
der Grabung gefragt werden. Es geschah nie ohne Einwilligung seiner Auftraggeber,
daß gegraben wurde. Bausch hätte ja auch für seine Arbeit
nichts bekommen. Wem sollte er die Scherben oder Knochenreste verkaufen?
Und er brauchte den geringsten Lohn dringend, denn außer seiner Arbeitskraft
besaß er jahrzehntelang nichts. Die Wissenschaftlerin, die frisierte
Bodenschätze vor sich zu haben glaubte, soll sich einmal von denen belehren
lassen, die dabei waren, wenn solche ausgegraben wurden, denn dann wird aus
dem Saulus ein Paulus werden. Wie schon oben gesagt, Menschen wie Bausch
sind selten."
Soweit also das offene Bekenntnis des Windecker Bürgers Friedel Kurz,
das allerdings, nach dem genauen Studium aller verfügbaren Unterlagen,
in einigen Punkten sicher korrekturbedürftig ist. Das ändert aber
nichts an der feststehenden Tatsache, daß ausnahmslos alle Windecker,
die Georg Bausch kannten, ihrem Mitbürger das Fälschen von prähistorischen
Artefakten oder gar das komplette "Türken" von etwa 100 bandkeramischen
Brandgräbern nicht zutrauten.
|
© Geschichtsverein Windecken
2000
Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Vereins.
|



