|
|
Aufregende Wochen für Theodor Jung
Er verfolgte Freilegung der "Wetterauer Brandgräber"
Von Rolf Hohmann
Die beiden ersten jungsteinzeitlichen "Wetterauer Brandgräber"
entdeckte der Windecker Brunnenbauer Georg Bausch 1906 in der
Butterstädter Gemarkung "Tannenkopf" auf einem Acker des
Gutsbesitzers Philipp Jung. In den beiden folgenden Jahren wurden hier
auf einem engbegrenzten Areal weitere 32 dieser ominösen
bandkeramischen Gräber freigelegt. Es waren vor allem die Beigaben
in Form von Schmuckketten aus durchbohrten und teilweise verzierten
Flußkieseln, die für Aufsehen in der Fachwelt sorgten.
Für die von Prof. Dr. Georg Wolff geleiteten Ausgrabungskampagnen
interessierten sich damals viele angesehene Prähistoriker, und
auch Vertreter des öffentlichen Lebens aus dem Landkreis Hanau
ließen sich auf dem "Tannenkopf" blicken. Gutsbesitzer Philipp
Jung stellte damals seine Äcker für die Ausgrabungen
kostenlos zur Verfügung. Für dieses großzügige
Entgegenkommen schenkte ihm Georg Wolff die aus Grab II geborgene erste
Steinkette.
Sein damals zwölfjähriger Sohn Theodor wurde von seinem Vater
angewiesen, die 1907 durchgeführten Ausgrabungen vor Ort
aufmerksam zu verfolgen. Nach dem Tod von Philipp Jung führte sein
Sohn zunächst den Betrieb weiter. Er verpachtete ihn dann und
wanderte 1925 in die USA aus. In hohem Alter schrieb Theodor Jung seine
Eindrücke von den aufregenden Ausgrabungswochen nieder. Die
Aufzeichnungen befinden sich im Besitz seiner Nichte Rita Janka
(Hanau), die sie dem Geschichtsverein Windecken kürzlich durch
Vermittlung von Erwin Toussaint (Butterstadt) zur Auswertung
überließ. Die Steinkette aus Grab II schwamm 1925 mit
über den großen Teich und in Amerika ist sie verschollen. Es
existiert aber ein Foto.
Die Schilderung von Theodor Jung ist der einzige Augenzeugenbericht
eines Laien über die damaligen Ausgrabungen auf dem
"Tannenkopf" und sie gibt Einzelheiten wieder, die in der Bewertung der
gegen Georg Bausch von Gudrun Loewe erhobenen
Fälschervorwürfe von Bedeutung sind. Von einigen
redaktionellen Änderungen abgesehen wird der handgeschriebene
Bericht nachfolgend im Wortlaut wiedergegeben:
 |
| Grossansicht laden | © GVW 2000 |
|
Der Gutshof von Philipp Jung vor dem Ersten Weltkrieg
Repro: Rolf Hohmann
|
"Im Jahr 1906 war ich 12 Jahre alt und ich
erinnere mich noch gut an den nassen Sommer und Herbst. Zu damaliger
Zeit gab es noch keine Erntemaschinen und es wurde alles mit der Hand
geschnitten. Meine Eltern hatten Saisonarbeiter und die Schnitter, wie
man diese Leute nannte, konnten oft tagelang nicht im Feld arbeiten,
denn es war zu nass für die Ernte. Das Getreide stand lange im
Feld und es mußte doch trocken sein, um es in die Scheune zu
fahren. An Maria Himmelfahrt waren viele Butterstädter zur
Wallfahrt in Sternbach. Ich war auch mit und da sah ich, dass auf dem
Feld des Wickstädter Hofs all der Hafer und viel Getreide noch auf
dem Halm standen. Selbst auf dem Halm war der Hafer bereits
ausgewachsen. Sogar an Allerheiligen war es noch sehr nass im Feld. Auf
den nassen Äckern am Ostheimer Weg hatte mein Vater Dickwurz, und
um diese zu den Mieten zu bringen, wurden an jedem Wagen 4 Pferde
gebraucht. Auch durfte der Wagen nicht zu schwer beladen werden, denn
sonst gingen die Räder zu tief in die Erde. Obwohl die Dickwurz-
und Kartoffelernte gut geraten war, wurden viele Kartoffeln und auch
Dickwurz faul. Sie hielten sich nicht so gut, wie in normalen Jahren.
Für die neue Aussaat mußte neues Saatgut gekauft werden und
auch neue Steckkartoffeln. Daher blieben auch viele Stoppelfelder
liegen und wurden nicht wie normal sofort nach der Ernte geackert. Auch
nicht zu vergessen, dass es auch noch keine Dreschmaschinen gab und
alle Frucht musste noch mit dem Dreschflegel mit der Hand gedroschen
werden.
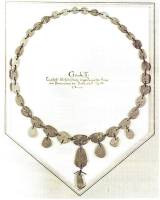 |
| Grossansicht laden | © GVW 2000 |
|
Die erste aus einem "Wetterauer Brandgrab" geborgene Steinkette erhielt der Gutsbesitzer Jung von
Professor Wolff als Geschenk. Sie ist in Amerika verschollen.
Repro: Rolf Hohmann
|
Um nun die Felder zu pflügen, die noch ungepflügt lagen,
ließ mein Vater etwa 80 Morgen mit dem Dampfpflug tief ackern. Es
war Neujahr 1907. Der Dampfpflug-Besitzer pflügte auch auf dem
Baiersröder Hof sowie auf dem Rüdigheimer Hof. Im März
lief ein Herr Bausch, er arbeitete für den Hanauer
Geschichts-Verein, über die mit dem Dampfpflug geackerten Felder
und fand ein paar dunkle Stellen, er suchte, ob er Dinge aus der
Römer-Zeit finden könnte. In Marköbel war in der
Römer-Zeit ein Kastell und im "Bösen Feld" ein Wachtposten
der Römer oder Vorposten. Er fand Teile von bronzenen Armreifen.
An dem Tag, an dem Herr Bausch über das Feld ging, war ich auch
auf den langen Äckern. Ich wollte die Grenzsteine freilegen, es
war ein schöner heller Tag, das Feld war am Abtrocknen, es war
Anfang März. Herr Bausch zeigte mir, wie die frühere Hohe
Straße durch die Röder Hohl lief. Er zeigte mir die
Richtungen der früheren Straße, die über die Langen
Äcker von Marköbel in Richtung Ostheim, Heldenbergen lief.
Man konnte sehen, daß in den gepflügten Äckern das Feld
trocken war. Er sagte mir, daß durch die frühere Hohe
Straße der Untergrund härter sei und dadurch nicht so viel
Wasser aufsauge, so daß man heute noch sehen könnte, wie die
frühere Hohe Straße von Mainz über die Wetterau nach
Fulda lief. Dabei fand Herr Bausch ein paar dunkle Stellen im Feld der
langen Äcker. Er fragte mich: "Hat dein Vater eine eingegangene
Kuh oder Pferd hier begraben?" Ich gab ihm die Antwort, daß ich
das nicht wisse. Herr Bausch ging zu meinem Vater und fragte, was das
sein könnte. Auch mein Vater konnte keine Antwort geben. So erbat
Herr Bausch um Erlaubnis, dorten graben zu dürfen.
Der Fürst von Ysenburg-Büdingen kam für die Unkosten der
Ausgrabungen auf. Prof. Wolff von der Universität Marburg und
Prof. Verworn von der Universität Göttingen leiteten die
Ausgrabungen. So viel ich mich erinnere, wurde 2 oder 3 Tage in der
Woche daran gearbeitet und mein Vater sandte mich jeden Tag, an dem
daran gearbeitet wurde, zu der Stelle und sagte: "Höre, was
gesprochen wird, du wirst dabei viel lernen und es wird dir in
Erinnerung bleiben." Die Arbeit verlief sehr langsam. Erst wurde die
Erde bis zur Pflugsohle abgehoben, dann nur mit dem Löffel sehr
vorsichtig die Erde abgehoben. So kam die erste Brandkette zu Tag. Es
wurde festgestellt, daß dieses Brandgräber aus der
jüngeren Steinzeit waren (Bandkeramik). Jeden Abend wurden die
Stellen mit Decken abgedeckt bis zum nächsten Arbeitstag. Viele
Herren waren dorten, um es zu besichtigen. Eine Liste werde ich
aufstellen, ein Teil aus der Erinnerung und einen Teil laut Bericht von
Prof. Wolff.
Als Zeugen waren zur Besichtigung an den Fundstellen:
| General-Direktor Braun |
Hanau
|
Prof. Schaub
|
Hanau
|
Baurat Thyriot
|
Hanau
|
Stadtschulinspektor Hahn
|
Hanau
|
Graf von Ysenburg
|
Büdingen
|
Hauptmann von Buttlar
|
Hanau |
Ferdinand Schwarz
Bernhartd Schwarz
Gustav Schwarz
|
Domänenpächter
Baiersröder Hof |
Gutsbesitzer Jung
|
Butterstadt
|
Sanitätsrat Koehl
|
Hanau
|
Dr. Steiner
|
Hanau
|
| Dr. Kropatschek |
Frankfurt M.
|
Prof. Wolff
|
Marburg
|
Prof. Verworn
|
Göttingen
|
Prof. Heiderich
|
Frankfurt
|
Bürgermeister Stroh
|
Marköbel
|
Bürgermeister Kimmel
|
Nieder-Issigheim
|
Sogar ein Prof. Dragendorff aus Rom war dorten, er hatte in Frankfurt
davon gehört, sowie, laut Bericht von Prof. Wolff, Landrat
Freiherr von Laur Hanau/M.
Es wurden mehrere Steinketten gefunden, sowie eine Wohngrube. Der Boden
ist dorten feiner Lehm, gelblich. Es wurde festgestellt, daß die
Leichen auf einen Kieferholzhaufen gelegt und verbrannt wurden. Da der
Boden sehr fein ist, ohne jede Steine, war es möglich, daß
die Gräber erhalten blieben. Alle Ketten sind in verschiedenen
Museen, nur 2 davon sind in Privat-Händen. Eine wurde dem
Fürst von Ysenburg-Büdingen gegeben, der die Ausgrabungen und
Unkosten bezahlte, und eine wurde meinem Vater gegeben, weil er das
Feld zur Ausgrabung frei gab. Auch dies ist im Buch von Hanau
beschrieben (Katalog West- und Südwestdeutscher Altertumssammlung
in V. Hanau von Dr. Ferdinand Kutsch. Zweiter Teil der sechzehn
Beilagen. Joseph Baer & Co. Frankfurt M. 1926).
 |
| Grossansicht laden | © GVW 2000 |
|
Verzierter Anhänger einer Kiesesteinkette aus einem Brandgrab in der
Butterstädter Gemarkung "Tannenkopf".
Repro: Rolf Hohmann
|
In der Praehistorischen Zeitschrift III. Band 1911 Verlag der
Praehistorischen Zeitschrift Leipzig ist eine Abhandlung von Prof. G.
Wolff über die Brandgräber in der Umgebung von Hanau mit
Tafel 1-14 sowie über Forschungen von anderen Professoren wie
neolithische Brandgräber, die nach Göttingen gekommen sind.
Auf Tafel 3 ist ein Bild der Kette von Grab II. Nach Ansicht der
Herren, die die Ausgrabung leiteten, waren die Löcher - die etwa
einen m/m groß sind - , mit einem Seilerbohrer gemacht worden.
Die Steinchen sind dunkelgrauer oder schwärzlicher Farbe. Auf
Seite 27 des Katalogs West- und Süddeutscher Altertumssammlung von
Dr. Ferdinand Kutsch steht, daß die Kette Grab II dem Landwirt
Jung in Butterstadt übergeben wurde. In dem Grab waren außer
der Kette kleine Knochenteile, die an der Universität Marburg als
Rehknochen festgestellt wurden, sowie zwei kleine Feuersteinsplitter.
In diesem Buch ist die Abbildung einer Kette, die in einem der Museen
ist wie die Kette in Original im Boden gefunden wurde und noch auf der
Original Erde liegt. Diese wurde ausgehoben an der Fundstelle.
Nicht nur auf den langen Äckern, sondern auch auf dem "bösen
Feld", Acker Toussaint, wurde eine Wohngrube gefunden, sowie eine
Spielzeug-Wiege aus Ton, schwarz und rotbemalt. Am Kirschberg wurden
Scherben gefunden und am Tannenkopf. In Butterstadt, am Tannenberg oder
Tannenkopf, ist eine Stelle, die schon vor dem I. Weltkrieg als die
Stelle bezeichnet wurde, an der man bei klarem Wetter die beste
Aussicht hatte, die im Kreis Hanau-Land liegt. Die Funde der
Steinketten, das waren Einzelsiedlungen aus der jüngeren
Steinzeit. Ich nehme an, daß in der damaligen Zeit nur
Einzelsiedlungen bestanden haben, denn es wurden nur einzelne
Wohnstellen gefunden."
|
© Geschichtsverein Windecken
2000
Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Vereins.
|



