|
|
Der Fall Bausch IV
Hatte Georg Bausch Heinzelmännchen unter Vertrag?
Die "bohrenden" Fragen stellt Rolf Hohmann
|
 |
| Grossansicht laden | © GVW 2000 |
Mit diesem Tischbohrgerät wurden die Versuche durchgeführt. In der Schale Kieselsteine, Stoppuhr, Schieblehre und Bohrer verschiedener Stärke.
Foto: Rolf Hohmann
|
Bis zum heutigen Tag werden von den
Prähistorikern die von Dr. Gudrun Loewe in ihrem Beitrag "Zur
Frage der Echtheit der jungsteinzeitlichen "Wetterauer
Brandgräber" (Germania 1958) angestellten theoretischen
Überlegungen und Untersuchungsergebnisse ohne einen Kritikansatz
für bare Münze genommen. Auch in der Populärliteratur
wird munter behauptet, daß Gudrun Loewe den Windecker
Brunnenbauer Georg Bausch, Vorarbeiter des angesehenen Wissenschaftlers
Prof. Dr. Georg Wolff, als Fälscher der Wetterauer
Brandgräber "entlarvt" hat. Das Ergebnis ihrer Recherchen
faßt Gudrun Loewe in folgendem Satz zusammen: "Die in diesem
Bericht vorgetragenen Bedenken haben mich zu der Überzeugung
gebracht, daß die "Wetterauer Brandgräber" nebst ihren
Beigaben von Bauschs Hand herrührten."
Weitgehend aufgrund von Indizien bezichtigte Gudrun Loewe rund 40 Jahre
nach dem Geschehen einen unbescholtenen, längst verstorbenen Mann
krimineller Machenschaften. Und zwar als Einzeltäter, denn die
Verfasserin deutet nirgendwo an, daß Bausch eventuell Helfer
hatte oder dubiosen Hintermännern als Strohmann diente. Auf Wunsch
der Bausch-Enkelin Maria Schmidt habe ich mich in den vergangenen zwei
Jahren intensiv mit diesem "Fälscherkrimi" beschäftigt und
alle erreichbare Literatur über die Fernleihe der Landeskundlichen
Abteilung der Stadtbibliothek Hanau bezogen. Die Kopien füllen
immerhin fünf breite Aktenordner. Außerdem führte ich
mit betagten Windeckern zahlreiche Gespräche.
Gudrun Loewe standen als einziges "handfestes" Beweismaterial nur die
wenigen erhalten gebliebenen Grabbeigaben zur Verfügung. Hier
bilden die Schmuck-Halsketten aus Kieselsteinen den Schwerpunkt. Sie
sorgten nach ihrem Auffinden kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges
für Aufregung unter den Fachwissenschaftlern. Da mich vorrangig
die Frage interessierte, welcher Zeitaufwand benötigt wurde, um
die Löcher in die Kieselsteine zu bohren und die Verzierungen
herzustellen, nahm ich die in den Jahren 1907/08 auf dem "Tannenkopf"
bei Butterstadt entdeckten und ausgebeuteten 32 Brandgräber und
vor allem die gleich große Zahl der Kieselsteinketten näher
in Augenschein. Mir wurde sehr schnell klar, daß Gudrun Loewe den
"Zeitfaktor" sträflich vernachlässigt hatte. Schon bei einer
groben Schätzung der in die Tausende gehenden Bohrlöcher
sowie Näpfchen- und Strichverzierungen hätte ihr bewußt
werden müssen, daß eine Person in der zur Verfügung
stehenden Zeit nicht in der Lage gewesen sein konnte, diese
Arbeiten durchzuführen. Gudrun Loewe mag zwar auf ihrem
Fachgebiet eine gute Theoretikerin gewesen sein, doch von
praktisch-technischen Dingen hatte sie offensichtlich wenig Ahnung.
 |
| Grossansicht laden | © GVW 2000 |
Diese selbstgesbastelte Vorrichtung zum Einklemmen der Kieselsteine erfüllten ihren Zweck hervorragend.
Foto: Rolf Hohmann
|
Die zentrale Frage "Wie kamen die Löcher in die Kieselsteine?"
beschäftigte die Wissenschaftler bis zum Erscheinen der
Loewe-Abhandlung im Jahr 1958. Auf Seite 426 bemerkt die Autorin: "Ungeahnte
technische Fähigkeiten der Steinzeitmenschen schienen sich in den
feinen Durchbohrungen und Verzierungen anzudeuten. Wolff setzt ohne
Bedenken voraus, daß die oft weniger als 1 mm feinen und bis zu 5
mm langen zylindrischen, anscheinend meist von beiden Seiten her
geführten Bohrungen mit dem Silexbohrer ausgeführt worden
seien." Gudrun Loewe führt dann weiter aus: "Die Vermutung,
daß die feinen Bohrungen und Punktverzierungen wie auch die bei
einigen Kieseln umlaufenden Halsrillen, nur mit einem neuzeitlichen
Stahlbohrer hergestellt sein können, bewog mich, eine Anzahl
Kiesel- und Schieferanhänger der Materialprüfungsanstalt der
Technischen Hochschule Darmstadt vorzulegen." Aus den vorhandenen
Unterlagen des Hanauer Geschichtsvereins geht - mit einer Ausnahme -
nicht hervor, aus welchen Gräbern die ausgewählten Artefakte
stammen und ob die untersuchten Stücke zusammen mit dem Gutachten
dem Historischen Museum Hanau zurückgegeben wurden.
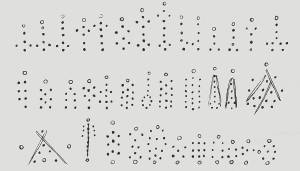 |
| Grossansicht laden | © GVW 2000 |
Auf dieser Skizze hat Prof. Wolff alle Verzierungsarten der Kieselsteine zusammengefasst.
Repro: Rolf Hohmann
|
Dem lediglich 13 Druckzeilen umfassenden Gutachten der
Materialprüfungsanstalt Darmstadt vom 1. November 1954 ist zu
entnehmen, daß die zur Verfügung gestellten Artefakte
zerschnitten und die Bohrkanäle durch Abschleifen freigelegt
wurden. Der Text befasst sich nahezu ausschließlich mit einem
besonderen Kieselstein: "Die Bohrungen sind auffallend fein und
besonders bei einem Kiesel zylindrisch durchgehend. Die Enden des
Bohrkanals sind an diesem Kiesel, im Gegensatz zu den anderen
Stücken, nicht konisch erweitert. Das Erscheinungsbild ist an
diesem Kiesel entsprechend einer heutigen Bohrstelle. Auch mit dem
Mikroskop ließen sich keine abgesetzten Rillen in der Wandung
beobachten, die auf ein etappenweises Arbeiten schließen
ließen. Es kann gesagt werden, daß die Bohrung besonders an
diesem Stück durchaus den mit neuzeitlichen Geräten
hergestellten Bohrlöchern entspricht und sich stark von den
abgesetzten und an den Enden konisch ausgeweiteten Bohrungen der
Steinzeit unterscheidet."
Es liegen weder von Gudrun Loewe noch von der
Materialprüfungsanstalt Angaben über Anzahl und Fundort der
untersuchten Artefakte vor. Am meisten erstaunt die Tatsache, daß
der Gutachter lediglich einige Bohrkanäle durch Anschleifen
"vorsichtig freigelegt" hatte, aber es offensichtlich für
überflüssig hielt, Steine selbst zu durchbohren, um
Vergleiche mit den Vorlagen anzustellen. Von einem Fachmann sollte man
eine solche Selbstverständlichkeit eigentlich erwarten
dürfen. Die ganze "Fälscherstory" hätte vielleicht einen
anderen Verlauf genommen, wenn dem Gutachter bei Bohrversuchen
bewußt geworden wäre, welcher Zeitaufwand dafür
benötigt wurde. Die Feststellung, daß zumindest eine Bohrung
die Verwendung eines modernen Stahlbohrers nahelegte, reichte für
Gudrun Loewe als Beweis für ihre Fälschertheorie aus. Da im
Gutachten jedoch ausdrücklich erwähnt wird, daß die
Bohrkanäle der anderen untersuchten Artefakte "konisch erweitert"
waren ist die Frage erlaubt, was für ein Bohrer dabei verwendet
wurde? Es darf weiter bezweifelt werden, daß dem Gutachter
original steinzeitliche Vergleichsmuster vorlagen. Darauf wäre
sicher hingewiesen worden. Diese kargen Ergebnisse wären auch in
der Lehrwerkstatt eines kleinen Ausbildungsbetriebes zu erzielen
gewesen.
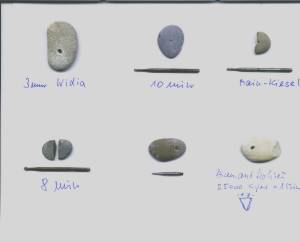 |
| Grossansicht laden | © GVW 2000 |
Zum Einsatz kamen verschieden Arten von Stahlbohrern. Das Ergebnis wurde auf einem Karton festgehalten.
Foto: Rolf Hohmann
|
Gudrun Loewe hat "zur Erprobung des Arbeitsvorganges" selbst zwei Löcher in einen Schieferanhänger aus der Büdesheimer Gemarkung gebohrt, und zwar "mit der biegsamen Welle eines Elektromotors."
Trotz intensiver Korrespondenz mit alteingesessenen Herstellerfirmen und
Museen habe ich nicht herausfinden können, ob es vor dem Ersten
Weltkrieg bereits biegsame Wellen für Bohrfutter gegeben hat.
Wahrscheinlich nicht. Gudrun Loewe setzte es offensichtlich als gegeben
voraus, daß Georg Bausch über ein solches Gerät
verfügte. Sie hat sich ihren "Versuch" zudem ziemlich leicht
gemacht, denn im Gegensatz zu den "harten" Kieselsteinen ist der weiche
Schiefer sehr leicht zu bearbeiten. Trotzdem hatte sie bei ihrem ersten
Bohrversuch Schwierigkeiten. Ihr Bohrer kam nämlich ins
Schleudern, "weil ich nicht rechtzeitig das feine Bohrmehl des Tonschiefers ausblies."
Man stelle sich einmal bildlich vor, wie der "Fälscher" Bausch
freihändig mit einem 1 mm-Bohrer an einer biegsamen Welle jeweils
zwei Löcher in die auf der "Verschlußseite" zumeist nur 13 x
11 Millimeter messenden Kettenglieder bohrte. Eine absurde Vorstellung
jenseits allen technischen Sachverstands.
Ich habe mit meinem Tischgerät in eine 5 mm starke Schieferplatte
ohne Schwierigkeiten und "schleuderfrei" ein Dutzend 1 mm-Löcher
gebohrt, ohne das Bohrmehl auszublasen. Nur Hermann Müller-Karpe
führte Bohrversuche an Mainkieseln durch. In seiner Abhandlung
"Zur Originalitätsfrage der Wetterauer Brandgräber" (1943)
berichtet er darüber: "Um zu sehen, ob modern hergestellte
Kieselanhänger den Bausch'schen ähnlich seien, habe ich
selbst einmal flache Mainkiesel gesammelt, wobei man unschwer die
bezeichnende ovale Form findet, die für unsere Ketten typisch ist,
und sie mit einem gewöhnlichen Stahlbohrer durchlocht." Leider
fehlt jeder Hinweis darauf, welche Stärke die Versuchs-Kiesel
aufwiesen und welche Zeit für eine Durchbohrung benötigt
wurde. Weiter schreibt Müller-Karpe: "Ein eigener Versuch,
Kiesel mit Holz-oder Knochenbohrern oder mit Silexsplittern zu
durchbohren, scheiterte leider an den technischen Voraussetzungen. Eine
Beobachtung jedoch verdient erwähnt zu werden. Während die
mit dem Stahlbohrer hergestellten Durchbohrungen sich nach einer Seite
verengten, also leicht konisch waren, konnte man bei den Bausch'schen
Kieseln beobachten, wenn man sie in der Bohrungsstelle auseinanderbrach
(was ich bei einer Anzahl der Exemplare tat), dass sie zweiseitig
gebohrt waren und dass die Seelenachsen in den meisten Fällen
nicht mathematisch genau übereinstimmten. Manchmal glaubte man
sicher feststellen zu können, dass die beiden Hälften mit
verschieden dicken Bohrern hergestellt seien. Der gleichen Art der
Durchbohrung begegnet man schließlich auch bei Hunde- oder
Schweinezähnen, die nicht nur in den Wetterauer Brandgräbern,
sondern zahlreiche auch sonstwo in steinzeitlichem Zusammenhang
gefunden werden und ebenfalls als Anhänger zu Halsketten getragen
wurden. Rein theoretisch gesehen steht eigentlich nichts im Wege
anzunehmen, dass die Wetterauer Bandkeramik-Leute als Halsschmuck
flache durchbohrte Flußkiesel verwendeten."
 |
| Grossansicht laden | © GVW 2000 |
Auf diesem im Mainzer Zentralmuseum erhalten gebliebenen Aquarell sind punktverzierte Kettenanhänger aus einem Butterstädter Brandgrab abgebildet. Man beachte die "ausgefransten" Bohrlöcher.
Repro: Rolf Hohmann
|
Mit den Mitteln der heutigen Elektronenmikroskopie und anderen
Verfahren kann nach Auskunft der Staatlichen
Materialprüfungsanstalt Darmstadt problemlos nachgewiesen werden,
ob bei Durchbohrug eines Kieselsteins ein Metallbohrer verwendet wurde.
Eine Analyse kostet € 300,- und um zu einem eindeutigen Ergebnis zu
gelangen, müßten mindestens zehn Kieselsteine aus
möglichst weit auseinanderliegenden Fundlagen und Zeitstellungen
untersucht werden. Sponsoren sind willkommen! Sollten in den
Bohrlöchern keine Metallrückstände nachgewiesen werden,
so wäre dies noch kein absoluter Beweis dafür, daß die
Bohrlöcher in den Artefakten aus jungsteinzeitlichen Wetterauer
Brandgräbern stammen oder doch erst Anfang des 20. Jahrhunderts
entstanden sind. Einige Fachleute sind nämlich der
Überzeugung, daß Diamantbohrer zum Einsatz gekommen sind.
Von den 32 auf dem "Tannenkopf" geborgenen Steinketten haben nur elf
die Wirren des Zweiten Weltkrieges unbeschadet überstanden. Sie
werden im Historischen Museum Hanau, im Archäologischen Museum
Frankfurt/Main und im Heuson-Museum Büdingen aufbewahrt. Sie
wurden von mir mit Unterstützung meines Sohnes fotografiert und
vermessen. Von neun verschollenen Exemplaren existieren Fotos. Bei den
restlichen zwölf, ebenfalls verschollenen Steinketten, sind wir
auf die im "Kutsch" und in den Veröffentlichungen von Georg Wolff
enthaltenen Angaben über die Zahl der Anhänger, Verzierungen
und so weiter angewiesen. Unter großem Zeitaufwand und in
akribischer Kleinarbeit habe ich die Gesamtzahl der Bohrlöcher und
annähernd die der Verzierungen ermittelt. Es wurden eingehende
Bohrversuche an Mainkieseln entsprechender Größe aus dem
Kieswerk Weiss bei Karlstein durchgeführt. Zum Einsatz kam eine
Mannesmann Tischbohrmaschine, wie sie im Prinzip bereits zu Beginn des
20. Jahrhunderts verwendet wurden, und 1 mm Stahlbohrer des Fabrikats
Connex aus dem Baumarkt. Ehe ich zu brauchbaren Ergebnissen kam,
mußte ich viel Lehrgeld bezahlen und der Verschleiß an
Bohrern war groß. Zunächst mußte eine Vorrichtung
geschaffen werden, um die in der Längsachse zwischen 33 und 11 mm
messenden Versuchsobjekte beim Bohren zu fixieren.
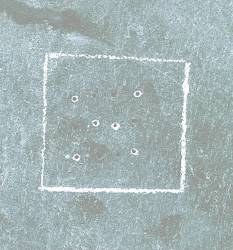 |
| Grossansicht laden | © GVW 2000 |
Ohne Mühe konnten in eine Schieferplatte 1mm Löcher gebohrt werden. Die Hälfte ist zum besseren Sichtbarmachen mit einem Kreidestift markiert.
Foto: Rolf Hohmann
|
Die Verwendung eines sonst üblichen Maschinenschraubstockes war
nicht möglich, da die zwar harten, aber gleiohzeitig spröden
Kieselsteine beim Einspannen oft zersprangen. Ich bastelte aus einem
Brett und zwei darauf befestigten, vorn zusammenlaufenden Leisten eine
Haltevorrichtung, die ihren Zweck hervorragend erfüllte. Da kein
Körner zum Markieren der Bohrlöcher verwendet werden konnte,
mußte der 1 mm-Bohrer sehr kurz eingespannt werden, weil er sonst
beim noch so gefühlvollen Ansetzen auf den zumeist gewölbten
Steinen abrutschte und zerbrach. Gelöst wurde das Problem der
Markierung auf der angebohrten Gegenseite mittels abgewinkelter
Pinzette und einem Filzstift. Da die Oberflächen der Kieselsteine
nicht ebenmässig waren, trafen die beiden "Seelenachsen" der
Bohrungen anfänglich nie auch nur einigermassen exakt aufeinander.
Nach jeweiligem einseitigen Unterfüttern der Steine wurden weitaus
bessere Ergebnisse erzielt. Ich hielt es für erforderlich, diese
Schwierigkeiten ausführlich zu schildern, denn damit hätte
sich auch der gelernte Weißbinder und spätere Brunnenbauer
Georg Bausch konfrontiert gesehen. Darüber hat sich Gudrun Loewe
wohl nicht eine Sekunde lang den Kopf zerbrochen, sondern vielmehr
durch das in meinen Augen dubiose Gutachten der
Materialprüfungsanstalt Darmstadt in ihrem fast schon zwanghaften
Drang nach "Entlarvung" gestärkt ihrer Überzeugung zum
Ausdruck gebracht, "daß die "Wetterauer Brandgräber" nebst ihren Beigaben von Bauschs Hand herrührten."
Meine Zählarbeit ergab bei den 20 im Original und als Foto
vorliegenden Steinketten 1977 Bohrlöcher. Da nichts gegen die
Annahme spricht, daß die restlichen 12 verschollenen Ketten
hinsichtlich der Zahl ihrer Glieder und Anhänger eine
ähnliche Zusammensetzung aufgewiesen haben, wurden per
Hochrechnung 1.186 Bohrlöcher ermittelt. Das ergibt in den 1907/08
geborgenen Kieselsteinketten eine Summe von 3.163 Bohrlöchern. Da
beim Interpolieren die nicht exakt zu ermittelnde Anzahl von Beigaben
in Form durchlochter Anhänger aus verschiedenen Materialien
unberücksichtigt blieben, dürfte die tatsächliche Zahl
der Bohrlöcher noch höher liegen. Die Härtegrade der
Steine sind sehr unterschiedlich, worauf schon die verschiedenen
Färbungen hinweisen. Für eine beiderseitig angesetzte Bohrung
unter Wasserkühlung bei 2600upm wurden zwischen sechs und acht
Minuten benötigt. Das ergibt einen Mittelwert von sieben Minuten.
Georg Bausch hätte also zur Herstellung der Bohrlöcher in den 32 Steinketten 3.163 x 7 = 22.141 Minuten = 369 Stunden = 15,4 Kalendertage à 24 Stunden = 46,1 Achtstundentage
aufwenden müssen. Dabei ist der Ausschuß nicht
berücksichtigt. Bei meinen Versuchen zersprang infolge zu stark
ausgeübtem Drucks auf den Bohrer etwa jeder zehnte Stein. Der oder
die Hersteller der Kieselsteinketten haben viel Mühe darauf
verwendet, die meisten Exemplare mit einer Vielzahl Napf- oder
Punktverzierungen und zusätzlich auch mit tief eingekerbten
Strichmustern zu versehen. Prof. Wolff hat alle Verzierungsarten in
einer Zeichnung festgehalten. Man mag angesichts der Formenvielfalt
nicht daran glauben, daß der einfache Brunnenbauer Georg Bausch
Schöpfer dieser Kunstwerke gewesen sein soll.
Die Zahl der "Näpfchen" auf den Anhängern und Kettengliedern
der 11 Originale schwankt erheblich. So sind es beispielsweise auf der
aus Grab XXV geborgenen Kette lediglich 36, auf der
"Anhängerkette" aus Grab V befinden sich jedoch auf beiden Seiten
nicht weniger als 1.250 Verzierungen. Ein bestimmtes Schema
hinsichtlich der Anordnung der Näpfchen und Strichverzierungen ist
nicht erkennbar. Die Gesamtzahl der Punktverzierungen auf den 11
Originalen beträgt 4.244 und die der Strichverzierungen 584. Eine
Hochrechnung für die 32 zur Diskussion stehenden Steinketten unter
Berücksichtigung der vorliegenden Literaturhinweise ergibt die
erstaunliche Zahl von 12.346 "Näpfchen" und 1.115
Kerbverzierungen. Alle Versuche, mit einem 1 mm-Stahlbohrer die
Napfverzierungen auf den abgerundeten Seiten der Kieselsteine
herzustellen, scheiterten trotz aller angewandten Tricks. Um
überhaupt ein Resultat zu erzielen, wurden mit nur
unbefriedigendem Ergebnis, weniger "bruchanfällige" 2 mm-Bohrer
eingesetzt. Für das Herstellen eines Näpfchens im relativ
flachen Mittelbereich eines Kieselsteins benötigte ich
durchschnittlich 45 Sekunden. Das ergibt 12.346 x 45 = 9.260 Minuten = rund 154 Stunden = 6,4 Kalendertage à 24 Stunden = 19 Achtstundentage.
Wohlgemerkt, hierbei ist nur die reine "Bohrarbeit" berechnet worden.
Die Zeit für das Einsetzen der einzelnen Steine in eine wie auch
immer geartete Haltevorrichtung blieb dabei unberücksichtigt.
Daß der oder die Hersteller der Steinketten während des
Bohrens die Kieselsteine mit der Hand festgehalten haben könnten,
schließe ich aufgrund meiner Versuche aus.
Bleibt noch die Frage offen, wie es dem "Meisterfälscher" Bausch
gelungen sein sollte, die Strichverzierungen tief in die harten
Kieselsteine einzukerben. Mit Stahlbohrern jeder Größe,
handelsüblichen Metallfeilen- oder Sägen ist dies
unmöglich. Das bestätigten mir alle befragten Fachleute.
Diese Strichverzierungen könnten nach ihrer Auffassung nur mit
einem Diamantwerkzeug eingeritzt worden sein. Von der
"Chefanklägerin" Gudrun Loewe wurde diese Möglichkeit jedoch
nicht in Betracht gezogen. Auch dieses Problem klammerte sie
offensichtlich bewußt aus. Mit der "Diamantenvariante" werde ich
mich in einem gesonderten Beitrag näher befassen. Um
überhaupt eine Berechnungsgrundlage zu haben, nehme ich vorerst
für jede Strichverzierung eine Mindest-Herstellungszeit von
durchschnittlich drei Minuten an. Das ergibt 1.115 x 3 = 3.345 Minuten = rund 56 Stunden = 2,3 Kalendertage à 24 Stunden = 7 Achtstundentage.
Außerdem hätte Georg Bausch zuvor erst die Kieselsteine
beschaffen müssen. Wahrscheinlich aus dem rund 15 km von Windecken
entfernten Main, denn in der nahe Windecken vorbeifliessenden Nidder
gab es keine freiliegenden Kiesbänke. Damals existierten
Kieswerke, in denen Berge sortierter Steine aufgeschüttet sind,
noch nicht.
Da die von mir an den Originalen durchgeführten Messungen ergaben,
daß die Größe der Steine von der "Anhängerseite"
bis zum Verschluß kontinuierlich abnimmt und auch die
Anhänger gleichmäßige Abstufungen aufweisen, hätte
das Einsammeln genau aufeinander abgestimmter Steine auf einer Kiesbank
im Main erhebliche Zeit in Anspruch genommen. Die durchschnittliche
Zahl Glieder der 20 nachzählbaren Steinketten beträgt 33, die
der Anhänger 17. Nach meinen Erfahrungen setze ich pro Kette
mindestens eine Stunde für das Einsammeln der Kieselsteine an. Der
Zeitaufwand dürfte jedoch erheblich größer gewesen
sein. Für 32 Kieselsteinketten hätte Bausch also die gleiche
Stundenzahl benötigt. Das wären 32 x 60 Minuten = 32 Stunden = 1,3 Kalendertage à 24 Stunden = 4 Achtstundentage.
Nicht berücksichtigt ist bei dieser Kalkulation die für An-
und Abfahrt erforderliche Zeit. Während meine Fahrten zum Kieswerk
Weiss mit dem PKW etwa eine halbe Stunde dauerten, standen Georg Bausch
nur die Eisenbahn bis zum Hanauer Hauptbahnhof und ein Fahrrad zur
Verfügung. Fazit: Für die Herstellung der 1 mm-Bohrungen, der
Napf- und Punktverzierungen sowie das Einsammeln der Kieselsteine
würde ein "Fälscher" mindestens 611 Stunden = 26,7 Kalendertage à 24 Stunden = 76 Achtstundentage
benötigt haben. Das wäre der minimalste Zeitaufwand
gewesen. Angesichts dieser Dimension stellt sich die Frage: Wieviele
Heinzelmännchen hatte Georg Bausch verpflichtet?
Unbeantwortet bleibt auch die Frage, mit welchem Gerät Georg
Bausch in seiner kargen Freizeit die Löcher und Verzierungen in
die mühselig zusammengeklaubten Kieselsteine gebohrt haben sollte.
Und vor allem: wo? Geld für eine der damals teuren Bohrmaschinen
hatte der "arme Schlucker" sicher nicht. Der "Meisterfälscher"
lebte mit seiner kinderreichen Familie in beengten
Wohnverhältnissen und heimliche "Dauerbohrungen" im "trauten Heim"
wären sicher bald Ortsgespräch gewesen. Der
Brunnenbauer ist wohl auch kaum mit einem Eimer voller Kieselsteine in
eine Schlosserei marschiert, hat hier eine Bohrmaschine mit Beschlag
belegt und tagelang Löcher in Kieselsteine gebohrt. Dann wäre
er bald in einer preußischen Klapsmühle gelandet. In seinem
Buch "Vorzeit gefälscht" (1967) hatte Autor Adolf Rieth in seinem
Kapitel über die Wetterauer Brandgräber bemerkt: "Die
genauere Untersuchung an den Bohrungen der Kiesel ergab, daß die
Bohrkanäle bei einem erstaunlich engen Durchmesser von kaum einem
Millimeter durchgehend zylindrisch waren, während man eigentlich
hätte erwarten können, daß sie sich von beiden
Öffnungen her leicht konisch verengt hätten. Silexbohrer, mit
denen man so feine Kanäle hätte bohren können, gab es
nicht. Diese Löcher mußten vielmehr mit einem Stahlbohrer,
wie ihn die Zahnärzte verwenden, hergestellt worden sein." An
dieser Stelle soll einmal die Frage gestellt werden, weshalb der
"Meisterfälscher" Georg Bausch eigentlich darauf "versessen"
gewesen sein sollte, solche feinen Löcher in die Kieselsteine,
Schieferplättchen und andere Artefakte zu bohren? Es wäre
für ihn doch technisch wesentlich einfacher gewesen, 2- oder 3
Millimeter-Bohrer zu verwenden. Auch auf diese Frage werden die
"Experten" eine Antwort schuldig bleiben.
Adolf Rieth hatte nun Stahlbohrer "wie ihn die Zahnärtzte
verwenden" ins Spiel gebracht. Obwohl dies nirgendwo sonst in der
Literatur nachzulesen ist, bin ich auch dieser "Spur" nachgegangen. Der
Nidderauer Zahnarzt Dr. med. dent. Klaus Racky erklärte sich
bereit, in seinem Dentallabor an einigen zur Verfügung gestellten
Mainkieseln Bohrversuche durchzuführen. Das Ergebnis ist auf
unserer Homepage "www.geschichtsverein-windecken.de" unter der
Überschrift "Die Zahnarztbohrer-Theorie" dürfte widerlegt
sein" nachzulesen. Durch unsere Internet-Beiträge aufmerksam
geworden, meldete sich aus Köln Frau Sigrid Kuntz. Sie stellte
hinsichtlich der "Gerätefrage" folgende Überlegung an:
"Wirklichkeitsnäher scheint es mir zu sein, an einen Fiedel- oder
Drillbohrer oder Dreul zu denken, wie ihn Goldschmiede früher
verwendet haben und in manchen Gegenden der Welt vielleicht immer noch
verwenden. Ein handliches Gerät, in der Beschaffung nicht allzu
kostenaufwendig, eventuell sogar selber herzustellen, wenn man
geschickt ist, und nach einiger Übung auch leicht zu bedienen.
Dabei wird ein in einen Bogen eingespanntes Seil über eine Rolle
geführt, über die der Bohrer gedreht wird; um das Ganze in
Bewegung zu setzen und zu halten, führt man den Bogen wie einen
Fiedelbogen beim Geigenspielen hin und her." Auch Ernst J. Zimmermann
stellt in seinem umfangreichen Werk "Hanau Stadt und Land" (vermehrte
Ausgabe von 1919) fest, daß die Punktverzierungen auf den
Kieselsteinen "mit dem Drillbohrer hergestellt" wurden.
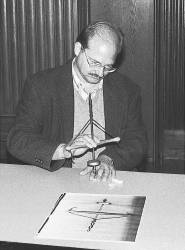 |
| Grossansicht laden | © GVW 2000 |
In der Zeichenakadenie Hanau demonstrierte Dr. Bruno-Wilhelm Thiele an Kieselsteinen die Handhabung eines Einhanddreuls.
Foto: Rolf Hohmann
|
Um auch diese Möglichkeit nachzuprüfen wandte ich mich an die
Zeichenakademie Hanau, an der auch Goldschmiede ausgebildet werden. Dr.
Bruno-Wilhelm Thiele demonstrierte, daß mit einem "Einhanddreul"
durchaus 1 mm-Löcher in Kieselsteine gebohrt werden können.
Er schätzte, daß dafür etwa acht Minuten benötigt
würden. Also etwa so lange wie mit einer elektrisch angetriebenen
Tischbohrmaschine. Bei der Dreul-Demonstration stand kein Stahlbohrer
zur Verfügung. Der Versuch soll aber noch durchgeführt
werden. Nähere Einzelheiten dazu unter der Überschrift "Wie
bekam Bausch die Löcher in die Kiesel?" auf unserer Homepage. Die
angeschriebenen Hartmetallwerkzeugfabriken warteten mit weiteren
interessanten Vorschlägen und Anregungen auf. Mehrfach empfohlen
wurde der Einsatz von Schleifmitteln beim Bohren. Ralf Danger vom
Technischen Kundendienst der Firma Gebr. Brasseler in Lemgo sandte das
Foto eines "Einmaldiamanten" und bemerkte dazu: "Unserer Meinung nach
können die Bohrungen nur mit einem derartigen Werkzeug hergestellt
werden." Über diese Möglichkeit und andere Vorschläge
wird in einem gesonderten Homepage-Beitrag berichtet.
Daß der Wolff-Vorarbeiter Georg Bausch in der ihm für seine
"Fälschungen" zur Verfügung stehenden knappen Freizeit neben
seiner "Kettenproduktion" und anderen, verbürgten Tätigkeiten
in den Jahren 1907/08 auch noch 32 Brandgräber ausgehoben, mit den
Beigaben versehen und ohne Verdacht zu erregen so "getürkt" haben
sollte, daß selbst die Koryphäen unter den damaligen
Fachleuten diesem "Schwindel" ohne Ausnahme aufgesessen sind, wäre
tatsächlich eine unüberbietbare Meisterleistung. Man
muß bedenken, daß nach Gudrun Loewe allein 1908 auf
dem "Tannenkopf" 20 Brandgräber ausgegraben wurden. Für
seine Familie hätte Georg Bausch neben seiner umfangreichen
"regulären" Ausgrabungstätigkeit beispielsweise auf dem
römischen Gräberfeld des Römerkastells Marköbel und
seiner "Fälscher-Schwarzarbeit" wohl keine Minute Zeit
erübrigen können. Immerhin hatten bis 1907 bereits fünf
seiner insgesamt acht Kinder das Licht der Welt erblickt. Über die
Brandgräber "als solche" und deren mögliches "Türken"
wird im nächsten Homepage-Beitrag ausführlich berichtet.
Trotz einer gewissen Unsicherheit bei den hochgerechneten Angaben
über die Anzahl der Bohrungen und Verzierungen sowie bei der
Beschaffung der Kieselsteine kann aufgrund meiner eingehenden Versuche
davon ausgegangen werden, daß eine Person für die
Anfertigung der zur Diskussion stehenden Kieselsteinketten über 70
Achtstundentage benötigt hätte; wahrscheinlich aber
wesentlich mehr. Und zwar innerhalb von knapp zwei Jahren. Ich werfe
Gudrun Loewe vor, in ihrem offensichtlich unbändigen Drang nach
"Entlarvung" von Georg Bausch als Fälscher, jeden Gedanken an die
zeitliche Machbarkeit der von ihr unterstellten Machenschaften des
Wolff-Gehilfen entweder bewußt unterdrückte oder ganz
einfach nicht das Format hatte, diesem wichtigen Faktor den
entsprechenden Stellenwert zuzuordnen. War sie so sehr erpicht darauf,
durch eine "wissenschaftliche Großtat" Anerkennung zu erhalten,
die ihr durch ihre sonstigen spärlichen Veröffentlichungen
nicht zuteil wurde, daß sie selbst das kleine Einmaleins der
wissenschaftlichen Forschung außer acht ließ? Etwas in
dieser Richtung vermuteten bereits Walter Gerteis und Bausch-Enkelin
Erna Schulz. Als "gelernte" Archäologin hätte Gudrun Loewe
wissen müssen, daß im Jahr X allgemein anerkannte Fakten
vielleicht schon zehn Jahre später durch neue
Ausgrabungsergebnisse widerlegt sein können. Ein wichtiger
"Eckstein" ihrer Fälschertheorie war für sie die
"Leichenbrandfrage", den sie mit einigen "Tricks" als Argument zu
untermauern versuchte. Durch die Ausgrabungen in Elsloo/Südlimburg
wissen wir aber längst, daß dieses Argument jede Beweiskraft
verloren hat. In diesem Punkt wird Gudrun Loewe eindeutig widerlegt,
wie später zu beweisen sein wird.
Das Fazit meiner noch nicht ganz abgeschlossenen Untersuchungen und
Überlegungen lautet: Der von Dr. Gudrun Loewe in ihrer 1958 in der
"Germania" veröffentlichten Abhandlung erhobene Vorwurf,
"daß die "Wetterauer Brandgräber" nebst ihren Beigaben von
Bauschs Hand herrührten" kann in dieser Form nicht aufrecht
erhalten werden. Sollte der Nachweis gelingen, daß zur
Herstellung der Bohrungen und Verzierungen der Grabbeigaben
moderne Stahlbohrer verwendet wurden, müßten zahlreiche
Hände mitgewirkt haben. Daß dubiose Hintermänner aus
irgendwelchen nicht erkennbaren Gründen dabei Regie geführt
haben könnten, wird in Windecken immer noch kolportiert. Leider
sind die "Wissenden"nicht bereit, etwas zur Aufklärung
beizutragen. Wie dem auch sei, für mich steht fest, daß
Georg Bausch zeitlich niemals auch nur annähernd in der Lage
gewesen wäre, die ihm von Gudrun Loewe zur Last gelegten
Fälschungen allein auszuführen. Diese Behauptung werde ich in
späteren Beiträgen noch erhärten. Die Wissenschaftler
sind aufgerufen, in ihren Veröffentlichungen vorerst den Hinweis
zu unterlassen, daß Gudrun Loewe den Windecker Brunnenbauer Georg
Bausch als Fälscher der Wetterauer Brandgräber in ihrer
Gesamtheit "entlarvt" hat.
|
© Geschichtsverein Windecken
2000
Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Vereins.
|



