|
|
Der Fall Bausch 5
Viele "Fälscher-Beweise" stehen auf tönernen Füßen
Von Rolf Hohmann
In ihrer Abhandlung "Zur Frage der Echtheit der jungsteinzeitlichen "Wetterauer Brandgräber"
(Germania, 1958) hat Gudrun Loewe mit zum Teil gewagten Vermutungen
versucht den Beweis dafür zu erbringen, daß der Windecker
Brunnenbauer Georg Bausch zwischen 1906 und 1920 rund 100 dieser im
nördlichen Hanauer Kreisgebiet und im Raum Frankfurt entdeckten
bandkeramischen Gräber eigenhändig gefälscht hat. Dies
war für einen bis zu seinem Tod im Jahr 1932 hochgeachteten Mann
posthum ein schwerer Vorwurf, den seine acht Enkelkinder nicht
unwidersprochen hinnehmen wollen. Im Namen ihrer Verwandtschaft hat
mich Bausch-Enkelin Maria Schmidt aus Langendiebach als Vorsitzenden
des Geschichtsvereins Windecken 2000 gebeten, in diesem "Fälscher
Krimi" neue Recherchen anzustellen. Die aus meiner umfangreichen
Quellensammlung und praktischen Versuchen gewonnenen Erkenntnisse
werden laufend auf unserer Homepage "www.geschichtsverein-windecken.de"
veröffentlicht. Nachfolgend werde ich versuchen, das von Gudrun
Loewe aufgebaute Theoriegebäude, soweit es die Brandgräber
"als solche" betrifft, zumindest stark zum Schwanken zu bringen. Da
weder sie noch ich ein original Wetterauer Brandgrab zu Gesicht
bekommen haben, bleibt es den Lesern dieser Abhandlung überlassen
zu beurteilen, ob Georg Bausch ein ebenso raffinierter wie "begnadeter"
Fälscher war, oder doch nur ein biederer Familienvater, der dem
Ehrgeiz einer Wissenschaftlerin zum Opfer fiel.
 |
| Grossansicht laden | © GVW 2000 |
|
Ein Blick auf dieses "Situationsfoto" eines in der Gemarkung Ostheim entdeckten neolithischen Brandgrabes reichte Gudrun Loewe aus, um auch die 99 anderen als "neuzeitliche Störung", sprich Fälschung, zu erkennen.
Repro: Rolf Hohmann
|
Welche "Beweise" führte Gudrun Loewe ins Feld, um ihrer
Fälschertheorie das nötige Gewicht zu verleihen? Dazu bemerkt
sie auf Seite 431 ihrer Abhandlung: "In der zusammenfassenden
Beschreibung betont Wolff die "vollkommene Gleichheit der Gräber
in Form und Größe und die große Übereinstimmung
der Art wie sie zuerst in Erscheinung treten." Der "fettig weiche"
Inhalt der Grabmulden hob sich "speckartig tiefschwarz" ab und war "so
lettenartig zusammenhängend, daß man ihn mit einer
großen Schippe unterstechen und herausnehmen konnte, ohne
daß er zerbröckelte." Anschließend führt Gudrun Loewe aus: "Dieses
kann man sich ohne weiteres vorstellen, wenn man das Situationsfoto von
Ostheim betrachtet, das in voller Deutlichkeit den Unterschied zwischen
der dunklen, lockeren Grabfüllung und dem helleren,
homogen-festen, mit dem Spaten säuberlich abgestochenen
Löß der Umgebung zeigt. Der Übergang zeichnet sich am
besten an der rechten oberen Begrenzung ab als eine gebrochene Linie
zwischen zwei verschiedenen Strukturen, während der
Farbunterschied nur wenig zur Geltung kommt. Hier besteht
offensichtlich keine durch Jahrtausende dauernde Lagerung gefestigte
Verbindung zwischen dem anstehenden Löß und der humosen
Einfüllung, die ein Ausheben der Grabfüllung nach Wolffs
Beschreibung unmöglich gemacht hätte. Alte Kulturschichten
pflegen sich durch besondere Festigkeit auszuzeichnen, die durch
eingeschlossene Brandreste nur noch gesteigert werden wird, und sind
mit dem sie umgebenden anstehenden Boden fest verbunden. Die Abbildung
des Brandgrabes von Ostheim gibt das typische Bild einer neuzeitlichen
Störung, die wahrscheinlich ebenso jung ist, wie die etwa 1 mm
feinen Durchbohrungen der Kieselbeigaben dieses Grabes."
Diese "feinen Durchbohrungen" scheinen es Gudrun Loewe angetan zu haben. Sie führt in ihrem Beitrag auf Seite 426 aus: "Ungeahnte
technische Fähigkeiten der Steinzeitmenschen schienen sich in den
feinen Durchbohrungen und Verzierungen anzudeuten. Wolff setzt ohne
Bedenken voraus, daß die oft weniger als 1 mm feinen und bis zu 5
mm langen zylindrischen, anscheinend meist von beiden Seiten her
geführten Bohrungen mit dem Silexbohrer ausgeführt worden
seien." Ich habe bereits in einem früheren Beitrag die Frage
gestellt, was den angeblichen Fälscher Georg Bausch eigentlich
bewogen haben könnte, ausgerechnet bruchanfällige und nur
schwer für den gedachten Zweck zu handhabende 1 mm Bohrer zu
verwenden? Da es keine Vergleichsobjekte gab, hätte er es doch mit
einem 2 oder 3 mm Bohrer wesentlich leichter gehabt, wie ich durch
eigene Versuche feststellte. Als 1958 der Loewe Beitrag in der
"Germania" veröffentlicht wurde, begann der Brite James Mellaart,
den man als "Archäologen mit der goldenen Hand" bezeichnete, mit
umfangreichen Ausgrabungen neolithischer Siedlungsplätze in
Anatolien. Darüber berichtet Rudolf Pörtner in seinem 1975
erschienenen Buch "Alte Kulturen ans Licht gebracht-Neue Erkenntnisse
der modernen Archäologe" im Eröffnungskapitel "Catal
Hüyük - Eine Terrassenstadt in der Steinzeit"
ausführlich. In seiner Beschreibung der Funde heißt es: "Die
Qualität der Fertigware beweist die hohe technische
Leistungsfähigkeit der Menschen von Catal Hüyük" und
weiter "Steinperlen wurden in Massen und mit so feinen Bohrungen
hergestellt, daß man sie mit modernen Stahlnadeln nicht
auffädeln kann." Was nun, Frau Dr. Loewe? Waren im 7.
vorchristlichen Jahrtausend in Anatolien nach dem Motto "Was nicht sein
kann, das nicht sein darf" auch Fälscher am Werk? Vielleicht
hatten den Steinzeitmenschen Außerirdische feinste Stahlbohrer
zur Verfügung gestellt? Zusammenfassend zitiert Pörtner den
erfolgreichen Ausgräber Mellhaat: "Die verbreitete Auffassung
vom neolithischen Menschen als einen armen Bauern, der sich abrackerte,
um durch schwere körperliche Arbeit einen kümmerlichen
Lebensunterhalt zusammenzuscharren, unfähig zu künstlerischen
Ausdruck und dazu verdammt, in einer Inzuchtgesellschaft in
Dörfern mit elenden Hütten zu leben - diese Auffassung ist
ebenso weit von der Wirklichkeit entfernt wie die Annahme, "haarige
Höhlenmenschen" hätten solche Meisterwerke geschaffen wie die
Höhlenmalereien von Lascaus und Altamira. Es ist bemerkenswert,
daß der moderne Mensch nicht fähig ist, Ebenbürtigkeit
(oder Überlegenheit) anzuerkennen." Dem ist nichts hinzuzufügen.
 |
| Grossansicht laden | © GVW 2000 |
|
Das bis zur Fundschicht freigelegte Brandgrab Nummer IV, entdeckt 1907 in der Gemarkung Butterstadt. Deutlich ist die in den hellen Lößboden eingetiefte schwarze Brandschicht zu erkennen.
Repro: Rolf Hohmann
|
Zurück zum Germania-Beitrag von Gudrun Loewe, die es penibel
vermeidet, Tatsachenbehauptungen aufzustellen. Wenn es "zur Sache"
geht, verwendet sie Begriffe wie "offensichtlich" und "anscheinend" oder "wahrscheinlich"
und sie hütet sich abschließend auch, Georg Bausch direkt
der Fälschung aller von ihm entdeckten Wetterauer Brandgräber
zu bezichtigen. Ihre abschließende Formulierung, sie sei aufgrund
der vorgetragenen Bedenken zu der "Überzeugung" gelangt, "daß die "Wetterauer Brandgräber" nebst ihren Beigaben von Bauschs Hand herrührten",
ist presserechtlich nicht angreifbar. Gudrun Loewe brachte es aber in
ihrer Abhandlung zu einer gewissen Meisterschaft darin, Zitate aus dem
Zusammenhang zu reißen und stichwortartig so zu interpretieren,
daß sie in die vorgegebene "Fälscherform" passen. Die weiter
oben angeführten Wolff-Zitate sind dessen Abhandlung "Neolithische
Brandgräber in der Umgebung von Hanau" entnommen, die im III. Band
der Praehistorischen Zeitschrift von 1911 veröffentlicht wurde. Um
den Unterschied zwischen 0riginal und "Bearbeitung nach Loewe" zu
verdeutlichen, werden nachfolgend die betreffenden Passagen im Wortlaut
wiedergegeben. Im Kapitel "Gräber" schreibt Prof. Georg Wolff: "Was
bei den Untersuchungen besonders auffiel, war die vollkommene
Gleichheit der Gräber in Form und Grösse und die grosse
Übereinstimmung der Art, wie sie zuerst in Erscheinung traten.
Zwar an der Farbe und Form der dunklen Flecke, welche infolge der
Tätigkeit des Dampfpfluges sich auf den braunen Ackerflächen
bemerkbar machten, konnte man zunächst nicht entscheiden, ob unter
ihnen eine Wohngrube oder ein Grab verborgen sei. Aber bei
vorsichtigem, schichtenweisen Abstechen des Bodens liess sich, wenn ein
Grab vorhanden war, dies an dem Übergang der mehr bröckeligen
dunklen Erde in eine speckartige tiefschwarze erkennen, die sich als
kreisrunde oder viereckige, an den Ecken abgerundete Scheibe deutlich
von der dunkelgrauen oberen Schicht und noch weit deutlicher von dem
gelben Lehm, der unter ihr lag, abhob. Denn mit einer einzigen Ausnahme
waren die Gräber, mochten sie isoliert liegen oder in den Boden
einer Wohngrube eingeschnitten sein, mit ihrem unteren Teil in den
gewachsenen Boden eingetieft. Im ersteren Falle erkannte man die
dunkelglänzende Fläche 35 bis 50 cm unter der
Oberfläche, also unmittelbar unter der durch den Dampfpflug
aufgerissenen Humusschicht, die infolgedessen auf eine gewisse
Ausdehnung durch die obersten Teile des Grabes dunkel gefärbt war.
Der unberührte Teil des Grabes erstreckte sich regelmässig
nur 10 bis 15 cm tief als eine von der erwähnten schwarzen Erde
mit den Knochenresten und Grabbeigaben angefüllte flache Mulde in
den gelben Lehm hinein." An dieser Stelle weist Wolff auf eine Fußnote hin, deren hier interessierende Satz lautet: "Der
Inhalt dieser Mulden war infolge der durch das darüber befindliche
lockere Erdreich eindringenden Feuchtigkeit und der - wohl durch den
Leichenbrand - in ihm befindlichen öligen Substanzen so
lettenartig zusammenhängend, dass man ihn, mit einer grossen
Schippe unterstechen und herausnehmen konnte, ohne dass er
zerbröckelte."
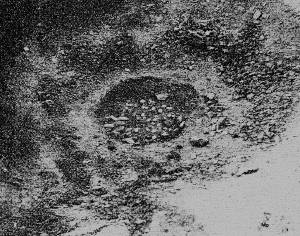 |
| Grossansicht laden | © GVW 2000 |
|
Dieses Foto versah Prof. Heiderich mit der Unterschrift: "Grab der Wohngrube 2 in situ".
Repro: Rolf Hohmann
|
Die von Gudrun Loewe zur Erhärtung ihrer Fälschertheorie
angeführten Argumente , soweit es die Brandgräber "als
solche" unter Außerachtlassung der durchbohrten Artefakte
betrifft, verdienen eine eingehende Betrachtung. Ihre Behauptung "Alte
Kulturschichten pflegen sich durch besondere Festigkeit auszuzeichnen,
die durch eingeschlossene Brandreste nur noch gesteigert wird, und sind
mit dem sie umgebenden anstehenden Boden fest verbunden" kann von
mir als Laie nicht auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüft
werden. In der mir zugänglichen Literatur habe ich keinen
entsprechenden Hinweis gefunden. Ich könnte mir aber gut
vorstellen, daß die jeweiligen Bodenverhältnisse
ausschlaggebend dafür sind, ob und wie sich die gewachsene Erde
beispielsweise mit dem sich in prähistorischen Abfallgruben
bildenden Humus im Lauf der Jahrtausende verbindet. Bei den von mir an
der Hohen Straße und in Mittelbuchen etwa 30 ausgegrabenen
bandkeramischen Abfallgruben habe ich als Autodidakt - die von mir vom
damaligen Kreisbodendenkmalpfleger Dr. Karl Dielmann erbetene
ständige Überwachung und Anleitung ließ sich nicht
verwirklichen - diesem Aspekt keine Aufmerksamkeit geschenkt. Die von
mir angefertigten Dias müßten von einem Fachmann ausgewertet
werden. Folgende Überlegungen sind für mich aber wesentlich
schwerwiegender. Setzen wir voraus, daß die von Gudrun Loewe
beschriebene, in Jahrtausenden entstandene "feste Verbindung"
von alten Kulturschichten mit dem sie umgebenden gewachsenen Boden
bereits vor dem Ersten Weltkrieg wissenschaftlich fundiertes
Allgemeingut war, stellt sich die Frage: Warum haben damals die vielen
an den Ausgrabungen an der "Hohen Straße" im nördlichen
Hanauer Kreisgebiet bis 1910 beteiligten Wissenschaftler, die Dutzende
Brandgräber aufgrund der "bröckeligen" Grabfüllung" und der fehlenden "festen Verbindung" der Erdschichten nicht sofort als "neuzeitliche Störung"
erkannt, sondern sie in zahlreichen Veröffentlichungen als
"sensationelle" Entdeckung bezeichnet? Spaten und Spatel hatten unter
anderem in die Hand genommen: Prof. Dr. Georg Wolff, Streckenkommissar
der Reichslimeskommission und stellvertretender Vorsitzender der
Römisch-Germanischen Kommission (RGK), Dr. Paul Steiner, Assistent
der RGK, Prof. Dr. Hans Dragendorff, erster Direktor der 1902
gegründeten Römisch-Germanischen Kommission (bis 1911),
anschließend Generalsekretär des Deutschen
Archäologischen Instituts (DAI), F.-K. Heiderich, Professor der
Anthropologie in Göttingen und Max Richard Konstantin Verworn,
Professor der Phisiologie in Göttingen. In seinem im Heft 56 des
"Korrespondenzblatt des Gesamtvereins der Deutschen Geschichts-und
Alterthums" 1908 erschienenen Beitrag "Neolithische Brandgräber in
den Gemarkungen Marköbel, Butterstadt und Kilianstetten bei Hanau"
führt Georg Wolff aus: "Nachdem auch hier am 29. März eine
erfolgreiche Grabung unter Leitung des Berichterstatters vorgenommen
und die bis dahin festgestellten teils ausgehobenen teils nur von oben
angeschnittenen Gräber genau aufgenommen waren konnte am 14. April
die immer wieder verschobene Aufdeckung einer größeren
Anzahl von Fundstellen vorgenommen werden, an der außer dem
Berichterstatter und Herrn Sanitätsrat Kohl auch die Herren Dr.
Steiner, Direktorialassistent Welcker und Oberlehrer Dr. Manger von
Frankfurt, Oberlehrer Dr. Helmke von Friedberg, Apotheker Koehl von
Langenselbold und Domänenpächter B. Schwarz vom
Baiersröder Hof teilnahmen."
Während heute interessierte "Amateurarchäologen" kaum eine
Chance haben, sich auf dem Gebiet der Bodendenkmalpflege unter Aufsicht
auch nur annähernd frei zu entfalten - die inzwischen
übermächtige Bürokratie hat sie fest im Griff-, gaben
damals Laien oft entscheidende Impulse. Sie eigneten sich durch
Literaturstudien profunde Kenntnis auf dem Gebiet der Vor- und
Frühgeschichte an. Sie führten außerdem Feldbegehungen
durch und nahmen aktiv an Ausgrabungen teil. Für Archäologie
interessierten sich im Landkreis Hanau vor allem Lehrer, aber auch
Ärzte, Sanitätsräte, Apotheker, Offiziere, Gutsbesitzer,
Geschäftsinhaber und so weiter. Der Brunnenbauer Georg Bausch als
Vertreter der "arbeitenden Klasse" war damals ein Außenseiter im
erlauchten Kreis der Amateurarchäologen aus der gehobenen
Gesellschaftsschicht. Das "Manko" seiner einfachen Herkunft glich er
durch sein ausgeprägtes und vielgerühmtes "Feeling" beim
Aufspüren vor-und frühgeschichtlicher Siedlungsspuren mehr
als aus. Es darf hier noch einmal daran erinnert werden, daß
Georg Wolff ein "gelernter" Gymnasialprofessor war und als Autodidakt
trotzdem mit Respekt als "Nestor" der archäologischen
Bodenforschung in der Wetterau bezeichnet wird. Der
Ausgräber von Babylon, Robert Koldewey, lehrte an der
Königlichen Baugewerk- und Maschinenbauschule in Görlitz, ehe
er seine wahre Berufung erkannte. Der in Olympia und Troja erfolgreiche
Ausgräber Wilhelm Dörpfeld studierte das Baufach und legte
1876 das Bauführerexamen ab. Erst seine Aufgabe, die
Ausgrabungsergebnisse in Olympia zeichnerisch zu dokumentieren,
ließ ihn seine "archäologische Laufbahn" einschlagen. Von
Heinrich Schliemann, dessen Wirken mit Wilhelm Dörpfeld untrennbar
verbunden ist, soll hier gar nicht erst die Rede sein. Die Beispiele
könnten beliebig fortgesetzt werden.
Vom 2. bis 6. August 1908 fand in Frankfurt die XXXIX. allgemeine
Versammlung der Deutschen Anthropologischen Gesellschaft statt, an der
laut Bericht 256 Mitglieder und Gäste teilnahmen, die namentlich
bekannt sind. Am Dienstag, 4. August, stand eine Fahrt in die Wetterau
auf dem Programm, deren Teilnehmer Zeuge der Ausgrabung einer Anzahl
zum Teil bis zur Fundschicht freigelegter Brandgräber wurden. Da
die Fundorte zu weit von den Bahnstationen entfernt lagen, benutzte man
PKWs für die Anfahrt. Im Korrespondenzblatt der Deutschen
Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte
(Sept./Dez. 1908) wird über diese Exkursion berichtet: "Eine
Anzahl Automobilbesitzer hatte sich bereit gefunden, den
auswärtigen Gästen - die einheimischen Teilnehmer des
Kongresses hatten von vornherein auf Beteiligung verzichten
müssen, weil unmöglich eine noch größere Zahl von
Menschen hätte etwas sehen können - ihre Wagen zur
Verfügung zu stellen; die Beteiligung war indessen so eine starke,
daß schließlich noch Mietautos zu Hilfe genommen werden
mußten. 94 Herren und Damen folgten der Führung des Leiters
der Ausgrabung, Prof. Wolff, zuerst über Vilbel, Bergen, Hanau,
Roßdorf zu der ersten Fundstätte in der Nähe des
Baiersröder Hofes bei Marköbel, dann in den
Kilianstädter Wald bei Büdesheim. An beiden Stellen waren die
gut vorbereiteten Ausgrabungen erfolgreich und ergaben die wirksamste
Erläuterung zu dem Vortrage des ersten Tages von Prof. Wolff und
der Abhandlung Prof. Steiners in der Festschrift, die beide sich mit
diesen Fundstätten beschäftigen." Welche
Versammlungs-Teilnehmer die Freilegung von Wetterauer Brandgräber
mit großem Interesse verfolgten, ist nicht bekannt. Mit einiger
Sicherheit dürften dabei gewesen sein Prof. Hans Dragendorff,
Präsident der Römisch-Germanischen Kommission, H. Feyerabend,
Museumsdirektor in Görlitz, Dr. W. Foy, Direktor des
Rautenstrauch-Joest-Museums in Köln, Dr. Gößler,
Archäologischer Konservator in Stuttgart, Dr. K. Hagen,
Abteilungsvorsteher im Museum für Völkerkunde Hamburg, E.
Krause, Konservator in Berlin, Dr. Kropatschek und Rudolf Welcker,
Direktions-Assistent am Historischen Museum Frankfurt.
Es bleibt festzuhalten, daß alle an der Freilegung der
Brandgräber aktiv beteiligten Wissenschaftler und die zahlreichen
Beobachter keinen Zweifel an deren Originalität hegten.
Über 30 Jahre lang nach ihrer Aufsehen erregenden Entdeckung
fanden die "Wetterauer Brandgräber" Eingang in die Fachliteratur.
Auch namhafte Autoren waren von der Echtheit dieser damals innerhalb
des bandkeramischen Kulturkreises nur vereinzelt beobachteten
Bestattungsform überzeugt. Während die Brandgräber "als
solche" wissenschaftlich anerkannt wurden, kamen Mitte der
dreißiger Jahre Zweifel an der Echtheit der durchbohrten
Grabbeigaben auf. Diese galten vor allem den Ketten aus Kieselsteinen
und Schieferplättchen. Gudrun Loewe fasst auf Seite 423 in ihrem
Germania-Beitrag zusammen: "Namhafte Übersichtswerke berichten
über die "Wetterauer Brandgräber" als Lokalgruppe: G.
Schwantes, Deutschlands Urgeschichte (1918 zuletzt 1952); C.
Schuchardt, Alteuropa (1918, zuletzt 1944), W. Bremer in Ebert XIV
(1929) und Buttler in Handb. d. Urgesch. Deutschlands 2 (1938). Noch
1954 zieht H. D. Kahlke "die Brandgräberfelder mit
Linienbandkeramik des Maintals" in Betracht trotz seiner eigenen
Fußnote "Viele Prähistortiker stellen die Echtheit der Funde
in Frage" und beschreibt sie mit Zitaten von Wolff und Kunkel. Zweifel
an der Echtheit der "Wetterauer Brandgräber" scheinen
hauptsächlich von der Marburger Schule G. von Menharts auszugehen:
A. Stroh hält 1940 die Gräber als solche für sicher,
mißt ihnen aber "bei den wenig eindeutigen Fundverhältnisen"
keine Bedeutung für das Verhältnis der Rössener zur
Spiralbandkeramik zu." Gudrun Loewe mußte natürlich auch die Arbeit von Hermann Müller-Karpe erwähnen und sie meint, "daß ihm ein klares Ergebnis"
versagt geblieben sei. Der junge Autor stand den hauptsächlich von
Georg Bausch entdeckten Brandgräbern und vor allem deren
ungewöhnlichen Beigaben durchaus skeptisch gegenüber.
Müller-Karpe hatte die von Georg Wolff und Dr. Steiner
angefertigten Grabungsprotokolle eingehend studiert und in Windecken
mit Einwohnern, die Bausch noch kannten, eingehende Gespräche
geführt. Für ihn reichten aber alle Indizien nicht aus, um
den Wolff-Vorarbeiter offen der Fälschung zu verdächtigen. Am
Schluß seiner 1943 verfassten Abhandlung resümiert er: "Ein
endgültiges unangreifbares Urteil, ob restlos echt oder
völlig geschwindelt, ist nach alledem nicht möglich.
Entscheiden wird hier, wie so oft in prähistorischen Fragen,
einzig der Spaten, wenn er wieder einmal auf den südlichen
Lößhöhen angesetzt wird." Diese Beurteilung nach
dem Grundsatz "Im Zweifel für den Angeklagten" hat Gudrun Loewe
wohlweislich nicht in ihre "Zitatensammlung" aufgenommen.
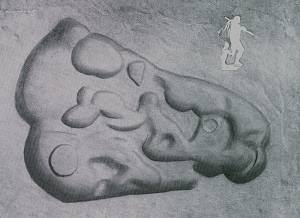 |
| Grossansicht laden | © GVW 2000 |
|
Von der "Wohngrube" 3 mit dem "integrierten" Brandgrab ließ Prof. Heiderich dieses Modell anfertigen. Er schenkte es dem Hanauer Geschichtsverein. Das Modell ist verschollen.
Repro: Rolf Hohmann
|
Erst ab Mitte der 30er Jahre äußerten einige Wissenschaftler
vorsichtige Zweifel an der Echtheit der Wetterauer Brandgräber,
welche sich aber ausschließlich auf die durchbohrten Artefakte
bezogen. Keiner von den Zweiflern konnte sich aber dazu durchringen,
die Gräber samt Beigaben unverblümt als Fälschung eines
biederen und angesehenen Mannes zu bezeichnen. Die Kieselsteinketten,
die den Zweiten Weltkrieg unversehrt überstanden hatten, wurden in
den Vitrinen des Museums für Vor- und Frühgeschichte im
Holzhausenschlößchen, in den Ausstellungsräumen des
Hanauer Geschichtsvereins und im Museum Büdingen von den Besuchern
staunend bewundert. Müller-Karpe schreibt in den einleitenden
Sätzen seiner Abhandlung: "Diese Schmuckketten, die heute mit
die schönsten und interessantesten Gegenstände der
Steinzeit-Abteilung unserer Sammlung darstellen, bildeten ehemals die
Beigaben von Brandgräbern, die nach gelegentlich aufgefundenen
verzierten Scherben und Steinwerkzeugen dem linearbandkeramischen und
dem Rössener Kulturkreis angehörten." Ein halbes
Jahrhundert nach den aufregenden Ereignissen auf dem "Tannenkopf" bei
Butterstadt betrat Dr. Gudrun Loewe mit viel Theaterdonner als "Deus ex
machina" die Bühne und teilte aufgrund ihrer Nachforschungen in
der "Germania" der Welt ihre Überzeugung mit, "daß die "Wetterauer Brandgräber" nebst ihren Beigaben von Bauschs Hand herrührten."
Sie hatte, wie bereits betont, nie ein Wetterauer Brandgrab mit eigenen
Augen gesehen. Nur aufgrund eines nicht sehr aussagekräftigen
"Situationsfotos" behauptet sie: "Die Abbildung des Brandgrabes von
Ostheim gibt das typische Bild einer neuzeitlichen Störung, die
wahrscheinlich ebenso jung ist, wie die etwa 1 mm feinen Durchbohrungen
der Kieselbeigaben dieses Grabes." Mit dieser Einschätzung
degradierte Gudrun Loewe die zahlreichen verdienstvollen
Fachwissenschaftler, die an den damaligen Ausgrabungen der
Brandgräber aktiv beteiligt waren, zu Dilettanten, um es einmal
weniger derb auszudrücken. Sollten diese anerkannten
Koryphäen tatsächlich nicht in der Lage gewesen sein bei der
Freilegung Dutzender Brandgräber zu erkennen, daß sie einem
"Meisterfälscher" aufgesessen waren, während die auf ihrem
Fachgebiet als "graue Maus" einzustufende Kollegin nur einen Blick auf
ein 50 Jahre altes schwarz-weiß Foto zu werfen brauchte, um auch
die anderen 99 Wetterauer Brandgräber pauschal als "neuzeitliche
Störung" und somit als Fälschung zu entlarven?! Die
Professoren Wolff, Dragendorff, Heiderich und die ganze andere Phalanx
der beteiligten Wissenschaftler müssen doch in ihren Gräbern
rotiert haben, als in der Germania 1958 die Abhandlung "Zur Frage der
Echtheit der junsteinzeitlichen "Wetterauer Brandgräber" von
Gudrun Loewe veröffentlicht wurde.
Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, sei noch an folgende Episode in
diesem "Fälscherkrimi" erinnert. Als auf dem "Tannenkopf" bei
Butterstadt die ersten Wetterauer Brandgräber mit ihren bis dahin
völlig unbekannten Steinketten freigelegt wurden und unter den
Wissenschaftlern für ziemliche Aufregung sorgten, wurde in
Diemarden bei Göttingen ein bandkeramischer Siedlungsplatz
ausgegraben. Wie anderenorts, fanden die Wissenschaftler, unter ihnen
Prof. F.-K. Heiderich, auch hier keine Gräber. Als deshalb die
Kunde von den aufsehenerregenden Funden aus der Wetterau Göttingen
erreicht hatte, trat man mit der Bitte an Prof. Wolff heran, einige
"Wetterauer Brandgräber" freilegen zu dürfen. Diese wurde
gewährt und Ostern 1908 begannen die Göttinger an der alten
"Hohen Straße" mit der Freilegung von drei Brandgräbern.
Darüber berichtete Prof. Heiderich am 21. Mai 1909 in einer
Sitzung des Anthropologischen Vereins Göttingen. Der Vortrag wurde
im Band 41 des Korrepondenz-Blattes der Deutschen Gesellschaft für
Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte veröffentlicht. Er ist
auf unserer Hompage unter der Überschrift "Professor Heiderich als
Gastausgräber" in der Rubrik "Der Fall Bausch" im Wortlaut
nachzulesen. Um nun auch den Mitgliedern des Anthropologischen Vereins
Göttungen ein "Erfolgserlebnis" zu bieten, fasste Prof. Heiderich
den Entschluß, das letzte der von Prof. Wolff "freigegebenen"
Gräber zu bergen und nach Göttingen transportieren zu lassen.
Er beschreibt den Vorgang wie folgt: "Dieses Gab haben wir, um es in
der Sitzung der Gesellschaft freilegen zu können, uneröffnet
dem Boden entnommen. Zu diesem Zwecke wurde eine an dem unteren Rande
zugeschärfter Blechkranz um das Grab herum in die Erde
eingedrückt, darauf wurde das Erdreich außerhalb des Kranzes
entfernt und nun ein starkes Blech unter dem Kranze durchgeschoben und
so die in dem Kranze befindliche Erdmasse von der Unterlage abgetrennt.
Dann wurde das Grab in eine Kiste verpackt und hierher transportierrt."
Anschließend sprach Professor Max Verworn über den
"Kulturkreis der Bandkeramik" mit besonderer Berücksichtigung der
Ausgrabungen bei Hanau und Diemarden.
 |
| Grossansicht laden | © GVW 2000 |
|
Das in der Sitzung des Anthrologischen Vereins Göttingen freigelegte Grab aus der Wohngrube 2. Die um den Leichenbrand gruppierten durchlochten Kieselsteine sind deutlich zu erkennen
Repro: Rolf Hohmann
|
Nach den Ausführungen Verworns wurden die anwesenden Mitglieder
des Antropologischen Vereins Göttingen Zeuge einer wohl
außergewöhnlichen Demonstration. Darüber wird im
Korrespondenzblatt berichtet: "Nach dem Vortrage wurde in der
Sitzung das noch ungeöffnet mitgebrachte Brandgrab der
großen Hanauer Grube geöffnet. Es fand sich bei der auf dem
Tisch vorgenommenen Ausgrabung außer dem Leichenbrand eine
einfache Kette aus unverzierten Steinchen, die von je einem Loch
durchbohrt an einer Schnur befestigt waren. Die Aushebung des Grabes
wurde von der zahlreich besuchten Versammlung mit gespannter
Aufmerksamkeit verfolgt." Man sollte eigentlich annehmen, daß
Prof. Heiderich beim Bergen dieses Brandgrabes eine "neuzeitliche
Störung" a là Gudrun Loewe hätte erkennen
müssen. Er hatte schließlich in Diemarden Abfallgruben
ausgehoben und kannte also deren Erdprofile. Schließlich wurde
die Erde um den eingelassenen Blechkranz soweit entfernt, daß ein
Blech untergeschoben werden konnte. Spätestens bei der
"Saalveranstaltung" in Göttingen müßte jedoch dem einen
oder anderen grabungserfahrenen, das Spektakel mit "gespannter Aufmerksamkeit"
verfolgenden Zuschauer, Bedenken hinsichtlich der Originalität des
Fundes gekommen sein. Schließlich genügte Gudrun Loewe nur
der Blick auf ein 50 Jahre altes schwarz-weiß Foto, um das
gezeigte Brandgrab als Fälschung zu "entlarven." Oder waren die
Sinne der Göttinger Wissenschaftler angesichts dieses
"Sensationsfundes" so durcheinander geraten, daß ihre
Urteilskraft stark beeinträchtigt war? Sollte Georg Bausch
tatsächlich der von Gudrun Loewe vermutete "Meisterfälscher"
gewesen sein, hätte ihm der Gedanke, daß in Göttingen
angesehene Wissenschaftler das "Ausheben" eines seiner "getürkten"
Brandgräber ehrfurchtsvoll verfolgten, sicher eine diebische
Freude bereitet. Vielleicht zündete er auch die Karbidlampe an
seinem Fahrrad an, ist in der Geisterstunde auf den "Tannenkopf"
gefahren und hat dort von der Höhe ein "homerisches
Gelächter" in die Nacht erschallen lassen. Das alles ist
drehbuchreif. Vielleicht findet sich ein phantasiebegabter Regisseur,
der den "Fälscherkrimi" um Georg Bausch verfilmt. Dem
Tagebuchfälscher Konrad Kujau hat man schließlich auch ein
filmisches Denkmal gesetzt. Während jedoch dessen Coup bald nach
der 1983 erfolgten Veröffentlichungen in einem Magazin aufgrund
handfester Beweise aufflog, fanden die von Georg Bausch entdeckten
"Wetterauer Brandgräber" als "bandkeramische Sondergruppe"
Aufnahme in vielen wissenschaftlichen Werken. Erst nach 50 Jahren
wurden alle Koryphäen, die keinen Zweifel an deren
Originalität hegten, von Gudrun Loewe aufgrund von zum Teil auf
sehr wackeligen Füßen stehenden Indizien als
"Laiendarsteller" diskreditiert.
Obwohl in jüngster Vergangenheit bei der Ausgrabung
jungsteinzeitlicher Siedlungen neue Erkenntnisse gewonnen wurden, die
einige von Gudrun Loewe aufgestellten Fälschungs-Indizien
eindeutig widerlegen, hielt es bisher kein Vor- und
Frühgeschichtler für opportun, ihren Germania-Beitrag einer
kritischen Betrachtung zu unterziehen. Sie schlossen sich vielmehr in
ihren Veröffentlichungen ohne Andeutung eines Zweifels der
"Überzeugung" ihrer Kollegin an. Hier zwei Beispiele: "Diese
vermeintlichen Gräber sind in den Jahren zwischen 1907 und 1920 in
der südlichen Wetterau, insbesondere in der Frankfurter und
Hanauer Gegend in größerer Zahl aufgetreten. Inzwischen sind
diese "Wetterauer Brandgräber" als Fälschungen erkannt" (Walter Meier-Arendt - Die bandkeramische Kultur im Untermaingebiet 1966). "Eine
Beschäftigung mit der Problematik bandkeramischer Brandgräber
kann nicht vorüber an den berühmt-berüchtigten
"Wetterauer Brandgräbern", die von G. Loewe (1958) als
Fälschungen erkannt wurden" (Edith Hoffmann - Zur Problematik
der bandkeramischen Brandbestattungen in Mitteleuropa 1973). Basierend
auf den klaren negativen Bekundungen in der Fachliteratur fielen auch
die Beurteilungen in den Veröffentlichungen innerhalb des
Heimatkreises aus. "Der wichtigste Fund innerhalb dieser Gräber
waren Ketten aus Kieselsteinen. Diese Ketten waren es auch, die diese
Gräber nach heutigem Wissensstand als Fälschung entlarvten" (Festschrift 1150 Jahre Marköbel - 850 Jahre Baiersröder Hof 1989). "Die
Anfang des 20. Jahrhunderts im Untermaingebiet und besonders
häufig im Gebiet des heutigen Main-Kinzig-Kreises entdeckten
"Wetterauer Brandgräber" erwiesen sich in den fünfziger
Jahren endgültig als Fälschung" (Führer zu archäologischen Denkmälern in Deutschland - Hanau und der Main-Kinzig-Kreis 1994). "Bei
den von dort berichteten bandkeramischen "Brandgräbern" handelt es
sich, wie bei allen diesbezüglichen Fundmeldungen aus der Region,
um klare Fälschungen" (Chronik Ostheim - Ein Stadtteil von Nidderau im Jahr 2000. Herausgegeben von der Stadt Nidderau).
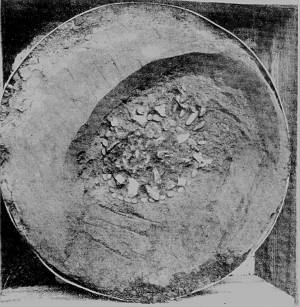 |
| Grossansicht laden | © GVW 2000 |
|
Mit einem Blechkranz eingefasst wurde dieses Brandgrab in einer Kiste verpackt vom Bahnhof Heldenbergen-Windecken nach Göttingen transportiert.
Repro: Rolf Hohmann
|
Gudrun Loewe zitiert in ihrer Abhandlung K. Schumachers Vermutung, daß "die
in der Wetterau so häufigen Brandgräber, die in dem nicht
minder dicht besiedelten Rheinhessen bis jetzt fehlen, mit der Zeit
wohl auch auftauchen werden" (Siedlungs- und Kulturgeschichte der Rheinlande 1 (1921, 39) und kommentiert: "Allein,
die Hoffnungen auf weitere Funde von Brandgräbern dieser Art in
der Wetterau oder anderwärts gingen nicht in Erfüllung. Seit
1920 wird kein entsprechender Grabfund mehr verzeichnet." Da Georg
Bausch ab 1920 keine Ausgrabungen mehr durchführte, war dies
für Gudrun Loewe ein weiterer Beweis für ihre
Fälschertheorie. Ein Jahr nach Erscheinen ihres Germania-Beitrags
begann in Elsloo (Südlimburg) eine Ausgrabungskampagne auf einem
bereits seit längerer Zeit bekannten bandkeramischen
Siedlungsplatz. Das dabei entdeckte Gräberfeld wurde 1966
eingehend untersucht und dabei 113 Bestattungen gefunden. Zur
Überraschung der Wissenschaftler waren darunter 47
Brandgräber. Aufgrund der Loewe-Veröffentlichung ging man
aber mit der entsprechenden Vorsicht zu Werke. Ausführlich
dokumentiert hat die Ausgrabungen P. J. Modderman in seinem 1970
erschienenen dreiteiligen Werk "Linearbandkeramik aus Elsloo und Stein"
und er schreibt auf Seite 70: "Im Hinblick auf die berüchtigten
Wetterauer Brandgräber (Loewe 1958) haben wir das Vorkommen von
bandkeramischen Brandgräbern mit Argusaugen betrachtet. Wir sind
aber jetzt davon überzeugt, daß wir es mit Brandgräbern
aus der Linearbandkeramik zu tun haben. Als positives Argument kann
gelten, daß zwanzig Brandgräber mit bandkeramischen Beigaben
versehen waren, welche aus Dechseln, Tonware und
Hämatitstücken bestanden. Ein negatives Argument ist das
völlige Fehlen irgendwelcher Datierungsmittel bei den
Brandgräbern ohne Beigaben." Abgesehen von den Ketten aus
Kieselsteinen und Schieferplättchen sowie den durchbohrten
Anhängern entsprach die Fundsituation in Elsloo weitgehend den
Beschreibungen der Brandgräber im nördlichen Hanauer
Kreisgebiet durch Prof. Wolff und Dr. Steiner. Dies veranlasste die
bereits zitierte Edith Zimmermann wohl zu ihrer "spekulativen"
Überlegung im Hinblick auf die Loewe-Abhandlung: "Trotzdem
stellt sich gerade im Zusammenhang mit den Brandgräbern in
Südlimburg und Mannheim-Seckenheim die Frage, ob wirklich alle in
der Wetterau gefundenen Brandgräber - was den Leichenbrand
betrifft - Fälschungen sind." Modderman geht in seinem
Ausgrabungsbericht detailliert auf die Fundsituation der einzelnen
Brandgräber ein. In der Regel gibt er an: "Dicht unter der Oberfläche liegendes Grab mit Leichenbrand."
Meistens wurden Fragmente von kalizinierten Knochen und Holzkohlereste
vorgefunden, aber nur geringe oder gar keine Beigaben. Der Autor
erwähnt bei der Beschreibung der Körper- und Brandgräber
an keiner Stelle, ob die Kulturschicht fest mit dem gewachsenen
Lehmboden verbunden war oder ob sich eine scharfe Trennungslinie
abzeichnete. Die Brandgräberfunde in Elsloo haben Gudrun Loewe in
einem entscheidenden Punkt ihrer "Beweiskette" widerlegt. Darüber
wird in einem weiteren Beitrag eingehend berichtet.
|
© Geschichtsverein Windecken
2000
Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Vereins.
|



