|
|
Der Fall Bausch 6
Es bleiben viele Fragen offen
Von Rolf Hohmann
Das intensive Sichten der inzwischen sechs breite
Aktenordner umfassenden Kopien aus der Fach- und Populärliteratur
zum Thema "Bandkeramische Kultur in Mitteleuropa", insbesondere der
Bestattungssitten, sowie die Recheren im Internet nehmen viel Zeit in
Anspruch. Es tauchen immer wieder Fakten auf, die den
"Fälscherkrimi" um den Windecker Brunnenbauer Georg Bausch in
neuem Licht erscheinen lassen. Ich werde mich auf Wunsch der
Bausch-Nachkommen weiter darum bemühen, die interessierte
Öffentlichkeit auf unserer Homepage über die Resultate meiner
Nachforschungen allgemeinverständlich zu informieren.
An dieser Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, daß ich meine
Beiträge zum "Fall Bausch" als Laie verfasse und diese deshalb
keinen Anspruch auf irgendwie geartete "wissenschaftliche Abhandlungen"
erheben. Ich verfüge jedoch über einen gesunden
Menschenverstand und befasse mich seit 1969 intensiv mit der
Prähistorie unseres Heimatkreises.
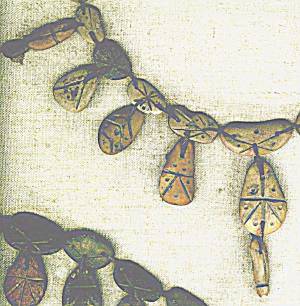 |
| Grossansicht laden | © GVW 2000 |
Völlig ungeklärt ist die Frage, wie diese Ritzverzierungen auf den Kieselsteinen hergestellt wurden.
Normale Metallwerkzeuge können keinesfalls verwendet worden sein.
Repro: Rolf Hohmann
|
Es sollte außerdem nochmals daran erinnert werden, daß
Gudrun Loewe bei Beantwortung der Frage, ob die "Wetterauer
Brandgräber" als solche echt oder gefälscht waren,
ausschließlich auf die Veröffentlichungen der damals
handelnden Personen als Zeitzeugen angewiesen war. Diese Feststellung
gilt in gleichem Maße natürlich auch für meine
Nachforschungen. Es handelt sich im "Fall Bausch", soweit es die
Originalität der Brandgräber betrifft, also um einen reinen
"Indizienprozeß", in dem verschiedene
Interpretionsmöglichkeiten möglich sind. Ich glaube
allerdings als "Verteidiger" gegenüber der "Chefanklägerin"
Gudrun Loewe im Vorteil zu sein, denn bei mir ist die bei Fachleuten
oft zu beobachtende "Betriebsblindheit" nicht zu befürchten.
Außerdem vertieft sich immer mehr der Eindruck, daß Gudrun
Loewe in ihrem Drang, den biederen Brunnenbauer Georg Bausch "auf
Biegen und Brechen" als Fälscher mit erstaunlichen
Fähigkeiten zu entlarven, in ihrer Beweisführung oft den Pfad
der wissenschaftlichen Tugend verlassen hat. Beispiele dafür habe
ich bereits früher angeführt.
Als die bis zu diesem Zeitpunkt in der bandkeramischen Kultur
Mitteleuropas nur ganz vereinzelt aufgefundenen Brandgräber vor
dem Ersten Weltkrieg an der Hohen Straße im nördlichen
Hanauer Kreisgebiet gleich zu Dutzenden auf engem Raum entdeckt wurden,
glich dies einer wissenschaftlichen Sensation. Darüberhinaus
entfachten die mit feinen Bohrungen versehenen Artefakte in Form von
Ketten aus Kieselsteinen und Schieferplättchen, aber auch
Anhängern aus Tonscherben, Knochen und Tierzähnen, rege
Diskussionen unter den etablierten Prähistorikern. Solche
"Kunstwerke" von außerordentlicher Vielfalt und solider
Fertigungstechnik waren aus den Gräbern des von neolithischen
Bauern besiedelten Lößbodens Mitteleuropas noch nie geborgen
worden.
An dieser Stelle sei Müller-Karpe zitiert, der Anfang der
vierziger Jahre des vorigen Jahrhunderts ebenfalls Bohrversuche an
Kieselsteinen durchführte, und bemerkte: "Der gleichen Art der
Durchbohrung begegnet man schliesslich auch bei Hunde- oder
Schweinezähnen, die nicht nur in den Wetterauer Brandgräbern,
sondern zahlreich auch sonstwo in steinzeitlichem Zusammenhang gefunden
werden und ebenfalls als Anhänger zu Halsketten getragen wurden.
Rein theoretisch gesehen steht eigentlich nichts im Wege anzunehmen,
dass die Wetterauer Bandkeramik-Leute als Halsschmuck flache
durchbohrte Flußkiesel verwendeten, zumal es die Leute in den
westalpinen Pfahlbauten ebenso taten, wie beispielsweise ein
Anhänger vom Bielersee beweist." Am Ausheben der "Wetterauer
Brandgräber" beteiligten sich viele anerkannte Vor- und
Frühgeschichtsforscher, die darüber in verschiedenen
wissenschaftlichen Publikationen berichteten. Keiner von ihnen
äußerte irgendeinen ernsthaften Zweifel an der
Originalität der Gräber und den außergewöhnlichen
Beigaben. Es herrschte unter den Prähistorikern jahrzehntelang
Konsens in der Auffassung, daß es sich hier um eine räumlich
eng begrenzte "Wetterauer Sondergruppe" innerhalb des bandkeramischen
Kulturkreises handelte. Solche "Kulturinseln" waren damals durchaus
bekannt. Erste vorsichtige Zweifel an der Echtheit der Steinketten,
nicht an den Brandgräbern "als solche", kamen vereinzelt Mitte der
30er Jahre auf.
Wie kamen nun die durchgehend 1 mm-Löcher in die zahlreichen, aus
den rund 100 Wetterauer Brandgräbern, geborgenen Artefakte? Gudrun
Loewe hat sich die Antwort auf diese eminent wichtige Frage in diesem
"Fälscherkrimi" aufgrund des in meinen Augen "dubiosen" Gutachtens
der Materialprüfungsanstalt Darmstadt vom 2. November 1954 leicht
gemacht. Ich meine, angesichts der Schwere des von ihr erhobenen
Fälschervorwurfs, allzuleicht! Sollte es sich bei den durchbohrten
Artefakten tatsächlich um neuzeitliche Fälschungen handeln -
was ich nach dem jetzigen Stand meiner Nachforschungen a priori nicht
ausschließen kann -, so könnten diese unmöglich von
einer Person allein ausgeführt worden sein. Dies aber hat Gudrun
Loewe behauptet und ich zitiere aus ihrem Germania-Beitrag : "Die in
diesem Bericht vorgetragenen Bedenken haben mich zu der
Überzeugung gebracht, daß die "Wetterauer Brandgräber"
nebst ihren Beigaben von Bauschs Hand herrührten." Durch meine
Untersuchungen der 32 Steinketten, die 1907/08 aus Brandgräbern
auf dem "Tannenkopf" bei Butterstadt geborgen wurden, habe ich diese
"Einmann-Fälschertheorie" wohl überzeugend ad absurdum
geführt. Nachzulesen in unserem im Juli 2003 veröffentlichten
Beitrag "Der Fall Bausch IV - Hatte Georg Bausch Heinzelmännchen
unter Vertrag?", in dem meine aufwendigen Bohrversuche detailliert
geschildert sind.
 |
| Grossansicht laden | © GVW 2000 |
Auf Äckern der Büdesheimer Gemarkung "Am Fuchsrain" wurden diese durchbohrten Anhänger aus Schiefer und Tierzähnen gefunden.
Repro: Rolf Hohmann
|
Alle Zweifler sind aufgefordert, meine Ergebnisse durch eigene Versuche
zu widerlegen. Ich stelle gerne meine Unterlagen zur Verfügung. In
erwähntem Beitrag habe ich dargelegt, daß die Bearbeitung
der harten Kieselsteine mit einem leicht zerbrechlichen 1
mm-Stahlbohrer sehr problematisch ist. Wesentlich leichter lassen sich
die Löcher und vor allem die zahlreichen "Napfverzierungen" mit
weitaus stabileren 2 oder 3 mm-Bohrern herstellen. Warum sollte der
"Fälscher" Georg Bausch ausgerechnet den schwierigsten Weg
gewählt haben? Da es keine "Vorbilder" gab, hätte Bausch den
"studierten Prähistorikern" ohne Argwohn zu wecken, auch
wesentlich leichter herzustellende 3-mm Bohrlöcher "unterjubeln"
können. Es bleibt weiter unerklärlich, weshalb Bausch
ausgerechnet so kleinformatige Kieselsteine für "seine" Ketten
ausgewählt haben sollte, die an den Verschlußseiten
durchschnittlich nur 13x11x3 mm messen. Aufgrund meiner Bohrversuche
weiß ich weiter wie schwierig es ist, in diese "Winzlinge" von
beiden Seiten her 1 mm-Löcher so zu bohren, daß ihre
"Seelenachsen" möglich exakt aufeinander stoßen.
Kieselsteine mit größeren Abmessungen wären wesentlich
leichter zu bearbeiten gewesen und keine irgendwie geartetete "Vorgabe"
hätten den "Meisterfälscher" daran gehindert, solche Steine
auszuwählen. Warum hat er es nicht getan? Diesen Fragen hat sich
Gudrun Loewe nie gestellt; und auch nicht die etablierten
archäologischen Wissenschaftler, die in ihren
Veröffentlichungen die Fälschervorwürfe ihrer Kollegin
ungeprüft übernahmen.
Es ist eine Sache, in einen Kieselstein aus dem Rhein-Main-Gebiet mit
einem Stahlbohrer aus der Zeit Anfang des 20. Jahrhunderts, wenn auch
unter relativ großem Zeitaufwand, 1 mm-Löcher zu bohren. Nun
weisen aber drei der im Historischen Museum Hanau aufbewahrten
Steinketten auch tief eingekerbte "Strichverzierungen" auf. Gudrun
Loewe setzt als selbstverständlich voraus, daß der
"Fälscher" Bausch diese ebenfalls mit einem Stahlbohrer
herstellte. Obwohl ich über einiges handwerkliches Geschick
verfüge, ist mir dies auch nicht ansatzweise gelungen. Auch durch
Verwendung von Metallfeilen und- Sägen konnten keine
entsprechenden Verzierungen hergestellt werden. Alle konsultierten
Fachleute aus der metallbearbeitenden Branche, denen ich entsprechende
Beschreibungen und Fotos zur Verfügung stellte, hielten die
Herstellung dieser Verzierungen auf Kieselsteinen mittels der vor dem
Ersten Weltkrieg handelsüblichen Metallwerkzeuge für
ausgeschlossen. Solche tief eingekerbten Rillen könnten bei den
harten Kieselsteinen nur unter Anwendung von Diamantwerkzeugen
entstehen. Dazu später mehr.
Die Frage: "Wie kamen die Löcher in die Kieselsteine?" hat
natürlich auch die Prähistoriker der "Entdeckerzeit"
beschäftigt und in ihrem Gefolge die Populär-Literaten.
Gudrun Loewe schreibt auf Seite 426 ihrer bereits oft erwähnten
Abhandlung: "Ungeahnte technische Fähigkeiten der
Steinzeitmenschen schienen sich in den feinen Durchbohrungen und
Verzierungen anzudeuten. Wolff setzt ohne Bedenken voraus, daß
die oft weniger als 1 mm feinen und bis zu 5 mm langen zylindrischen,
anscheinend meist von beiden Seiten her geführten Bohrungen mit
dem Silexbohrer ausgeführt worden seien." Gudrun Loewe spricht
hier definitiv von "zylindrischen" Bohrungen, was aber dem von ihr im
Wortlaut veröffentlichten Gutachten der
Materialprüfungsanstalt Darmstadt widerspricht. Darüber ist
ausführlich in einem vorangegangenen Beitrag berichtet worden.
Prof. Wolff widmet der "Bohrerfrage" in seiner Abhandlung "Neolithische
Brandgräber in der Umgebung von Hanau" lediglich zwei Sätze: "Diese
Durchbohrungen sind, wie sich an Exemplaren, welche an diesen wenig
widerstandsfähigen Stellen zersprungen waren, erkennen liess, von
beiden Seiten ausgeführt, da sie von einem engeren Teil in der
Mitte sich nach beiden Aussenseiten ein wenig verbreiterten. Ihre
Herstellung durch Silexbohrer bedeutet, wenn man die Härte des
Materials und die geringe Grösse vieler Steinchen, sowie den
dadurch bedingten geringen Durchmesser der Löcher bedenkt, - er
beträgt in manchen Fällen noch keinen Millimeter - eine
anerkennungswerte Leistung".
Zitiert werden soll Adolf Rieth aus seinem Buch "Vorzeit
gefälscht", in dem der Autor bezüglich der Wetterauer
Brandgräber im Kapitel "Gefälschte Jungsteinzeit"
hahnebüchenen Unsinn verzapft: "Die genauere Untersuchung an
den Bohrungen der Kiesel ergab, daß die Bohrkanäle bei einem
erstaunlich engen Durchmesser von kaum einem Millimeter durchgehend
zylindrisch waren, während man eigentlich hätte erwarten
können, daß sie sich von beiden Öffnungen her leicht
konisch verengt hätten. Silexbohrer, mit denen man so feine
Kanäle hätte bohren können, gab es nicht. Diese
Löcher mußten vielmehr mit einem Stahlbohrer, wie ihn die
Zahnärzte verwenden, hergestellt worden sein. (Für seine
Anhänger hatte Bausch gelegentlich auch Schiefer von Schultafeln
verwendet)."
Es sei hier zum wiederholten Mal angemerkt, daß sich Gudrun Loewe
in der "Löcherfrage" auf das in meinen Augen dubiose Gutachten der
Materialprüfungsanstalt Darmstadt vom 2. 11. 1954 bezieht - von
einer "genaueren Untersuchung kann überhaupt keine Rede sein -,
das in früheren Beiträgen bereits zitiert wird. Dort ist aber
nur von einem (!) Kiesel die Rede, bei dem die Bohrung "zylindrisch
durchgehend" ist, während alle anderen an den Enden konisch
erweitert sind. Von "durchgehend zylindrisch" kann also gar keine Rede
sein. Die Behauptung Rieths, daß Bausch die Löcher in den
Kieselsteinen mit Bohrern hergestellt habe, "wie ihn die Zahnärzte
verwenden", ist eine freie Erfindung des Autors. Nirgendwo in der
einschlägigen Literatur ist davon die Rede. Und doch haben diese
Behauptung andere ohne jede Nachprüfung übernommen.
Wir sind aber auch dieser Spur nachgegangen. Nachzulesen im Beitrag
"Die "Zahnarztbohrer-Theorie" dürfte widerlegt sein" (März
2003). Schließlich behauptet Adolf Rieth auch noch: "Für
seine Anhänger hat Bausch gelegentlich auch Schiefer von
Schultafeln verwendet." Hier unterstellt Adolf Rieth dem Windecker
Brunnenbauer mit einer Leichtigkeit sondersgleichen, daß er zur
Herstellung von Schieferanhänger "zeitgenössische"
Schultafeln verwendete. Und diese Dreistigkeit sollten die damaligen
studierten Vor- und Frühgeschichtler nicht bemerkt haben? Dann
wären sie tatsächlich "Deppen" gewesen und man hätte die
von ihnen unterrichteten Studenten bedauern können. Daß in
einem oft zitierten Buch ein solcher Unsinn "verzapft" werden konnte,
ist letztlich dem früher bereits beschriebenen besonderen
"Zitaten-Auswahlsystem" von Gudrun Loewe zuzuschreiben. Sie bemerkt auf
Seite 427 ihrer Abhandlung: "Die Beobachtung, daß zwei
Kilianstädter und ein Büdesheimer Anhänger "aus dem
platten blauschwarzen Schiefer unserer Kinderschreibtafeln" bestehen,
hat Wolff keineswegs beunruhigt." Obwohl hier wieder ein Zitat aus
dem Zusammenhang gerissen wurde und sich Prof. Wolff etwas
mißverständlich ausgedrückt hat, ist doch klar zu
erkennen, daß die Anhänger nicht aus einer
Schul-Schiefertafel gefertigt wurden, sondern aus dem gleichen
Material, das zur Herstellung derselben Verwendung fand.
Auch hier soll das Original-Zitat aus der Wolff-Abhandlung
"Neolithische Brandgräber in der Umgebung von Hanau" wiedergegeben
werden, veröffentlicht in der "Praehistorischen Zeitschrift" III.
Band 1911: "Diese Übereinstimmung bezog sich auch auf das
Material, und zwar in gleicher Weise im Kilianstädter Walde wie
auf dem Büdesheimer Felde. Dort bestanden zwei Anhänger, hier
einer aus dem platten blauschwarzen Schiefer unserer
Kinderschreibtafeln, alle anderen aus einem weichen,
silberglimmerhaltigen, rauhbrüchigen und im Zustande halber
Verwitterung leicht zerbröckelnden Schiefer von grauer Farbe, der
im Bundsandstein des Niddertales verkommt und, wie nachgewiesen werden
konnte, bei dem benachbarten Heldenbergen am Abhange zwischen der
Nidder und dem römischen Erdlager zutage tritt." Was mag Georg
Bausch veranlasst haben, nur drei Anhänger aus
"Schultafel-Schiefer" zu fälschen? Einen einleuchtenden Grund
dafür mag ich nicht zu erkennen. Gudrun Loewe schreibt weiter: "Wir
müssen heute aber fragen: Wo konnten die Steinzeitler in der
Wetterau solchen Schiefer finden? Oder wann mag das Material für
die drei Stücke ins Land gelangt und hier verarbeitet worden sein?"
Diese Frage einer "gelernten" Archäologin ist schon etwas kurios.
Bei allen Ausgrabungen bandkeramischer Siedlungsplätze in der
Wetterau werden "massenweise" Werkzeuge aus Feuerstein geborgen, den es
hier nicht gibt. Die nächsten Flintvorkommen befinden sich bei
Krefeld und Duisburg. Die Frage: Wie kommt Feuerstein in die Wetterau,
stellt sich nicht. Man weiß, daß bereits in der
Jungsteinzeit ein reger Handel stattfand. Warum sollten also leicht zu
bearbeitende Schieferplatten nicht auch als Handelsgut aus den relativ
nahegelegenen rheinischen Lagerstätten in die Wetterau gekommen
sein? Gudrun Loewe setzt sich aber auch hier dem Verdacht aus, durch
ihre Zitatauswahl und subjektive Fragen ein weiteres Verdachtsmoment
gegen Georg Bausch zu konstruieren. Die Frage, ob die Wetterauer
Brandgräber "als solche echt sind oder von Georg Bausch "durch die
Bank" gefälscht wurden, wird in jüngster Zeit immer mehr
zugunsten der Echtheits-Befürworter beantwortet.
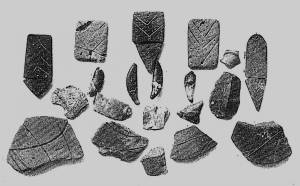 |
| Grossansicht laden | © GVW 2000 |
|
Diese zum Teil durchbohrten Artefakte wurden aus bandkeramischen Fundstellen im Kilianstädter Wald geborgen.
Repro: Rolf Hohmann
|
Es besteht überhaupt kein Zweifel daran, daß die über
40 in Elsloo in den 60er Jahren ausgegrabenen bandkeramischen
Brandgräber von der Anlage und den "normalen" Beigaben her
gesehen, denen ein halbes Jahrhundert zuvor an der Hohen Straße
im Landkreis Hanau entdeckten auffallend gleichen. Darüber wird
noch ausführlich zu berichten sein. Diese Fundumstände haben
Edith Hoffmann in ihrer 1973 veröffentlichten Abhandlung "Zur
Problematik der bandkeramischen Brandbestattungen in Mitteleuropa" zu
der Frage veranlasst, "ob wirklich alle in der Wetterau gefundenen Brandgräber - was den Leichenbrand anbetrifft - Fälschungen sind." Sie schränkt aber ein: "Um
nicht mißverstanden zu werden: Die "Wetterauer Brandgräber"
als Sondergruppe mit den für sie spezifischen Beigaben wurden von
G. Loewe gewiß zu Recht als Fälschungen entlarvt." Die
Autorin geht aber nicht so weit, Georg Bausch als alleinigen
Fälscher der Gräber und deren Beigaben zu bezeichnen. Ich
glaube zum jetzigen Zeitpunkt bereits genügend Beweise dafür
gefunden zu haben, daß diese Loewe-Behauptung nicht länger
aufrecht erhalten werden kann. Edith Zimmermann schreibt weiter: "Erwogen
sollte lediglich - was heute leider nicht mehr nachzuprüfen und
deshalb im Grunde rein spekulativ ist -, ob sich unter den etwa 100
nicht doch einige "echte" bandkeramische Leichenbrände befinden,
die dann in Ermangelung repräsentativer Ausstattungen durch
Mithilfe von G. Wolffs Mitarbeiter G. Bausch erst ins rechte Licht
gesetzt wurden."
Es darf also über die Echtheit der Wetterauer Brandgräber
"spekuliert" werden. Während Gudrun Loewe aufgrund ihrer
Literatur-Recherchen zu der "Überzeugung" gelangt ist, daß
alle Gräber von Georg Bausch gefälscht wurden, behaupte ich
nach dem Studium der gleichen Unterlagen und den Erkenntnissen von
Ausgrabungen nach 1958, daß sie echt waren. Die Antwort auf die
Frage nach der Originalität der Kieselsteinketten bleibt - wie
bereits mehrfach betont - vorerst ausgeklammert.
Gudrun Loewe zählt am Schluß ihres Germania-Beitrags "Zur
Frage der Echtheit der jungsteinzeitlichen "Wetterauer
Brandgräber" ihre "Hauptargumente" auf, die den Ausschlag für
ihren Fälschervorwurf gegen Georg Bausch gaben. Unter 2
heißt es: "Die Auffindung ist persönlich und zeitlich gebunden, mithin kann der Verbreitung keinerlei Wert beigemessen werden."
Sie bezieht sich dabei auf die Tatsache, daß Georg Bausch die
meisten (nicht alle!) Wetterauer Brandgräber entdeckt hatte und
nach seiner Pensionierung als Vorarbeiter des Historischen Museums
Frankfurt am Main keine weiteren mehr aufgefunden wurden. Was Gudrun
Loewe als weiterer Beweis für ihre "Fälschertheorie" diente,
ist keiner, denn seit 1920 fanden in "Wolff's Revier" an der Hohen
Straße zwischen Windecken und Marköbel keine Ausgrabungen
bandkeramischer Siedlungsreste mehr statt.
Ergo: Wo nicht gegraben wird, kann auch nichts gefunden werden! Nach
Gudrun Loewe (S. 432) wurden zwischen 1907 und 1910 im nördlichen
Hanauer Kreisgebiet 70 der etwa 100 neolithischen Brandgräber
ausgehoben. Ihre Entdeckung war der Tatsache zu verdanken, daß
auf einem großflächigen Acker des Gutsbesitzers Philipp Jung
aus Butterstadt auf dem "Tannenkopf" Anfang des Jahres 1907 beim
erstmaligen Einsatz eines Dampffluges neolithische Kulturschichten
angeschnitten wurden. Darüber berichtet Professor F. K. Heiderich,
der drei Brandgräber freilegen durfte, in einem Vortrag vor dem
Anthropologischen Verein Göttingen: "Die Wohnstellen waren an der
Erdoberfläche als große dunkle Fläche zu erkennen. Als
ich am ersten Morgen über die Felder ging, war ich erstaunt, wie
stark an Wohnstellen besetzt jene Gegend war." Später einigten
sich die Wissenschaftler darauf, die Wohnstellen als Abfallgruben zu
bezeichnen.
Prof. Georg Wolff hat die zwischen 1907 und 1910 im nördlichen
Hanauer Kreisgebiet unter seiner Aufsicht durchgeführten
Ausgrabungen in seinem erwähnten Beitrag "Neolithische
Brandgräber in der Umgebung von Hanau" ausführlich
beschrieben. Auf Seite 10 erwähnt er: "Ein
außergewöhnlich grosser Prozentsatz der Gräber ist an
Feldwegen aufgedeckt, weil dort am leichtesten Erlaubnis zum Graben zu
erhalten war." Er fährt dann fort: "Es ist kein Zweifel,
dass auf den durch diese Gewannwege, die sämtlich neueren
Ursprungs sind, begrenzten Äckern noch viele Hunderte von
Gräbern liegen, und dass solche auch in den übrigen
Gemarkungen an der hohen Strasse und höchstwahrscheinlich in den
übrigen Teilen der Wetterau, wo gleiche Bodenverhältnisse
betehen und dieselbe neolithische Kultur nachgewiesen ist, sich bei
zielbewusstem Suchen finden werden."
Müller-Karpe hat am Schluss seines Beitrags "Zur Originalitätsfrage der Wetterauer Brandgräber" (1944) bemerkt: "Ein
endgültiges unangreifbares Urteil, ob restlos echt oder
völlig geschwindelt, ist nach alledem nicht möglich.
Entscheiden wird hier, wie so oft in prähistorischen Fragen,
einzig der Spaten, wenn er wieder einmal auf den südlichen
Lösshöhen der Wetterau angesetzt wird".
Der seit zwei Jahren im "Fall Bausch" aktive Geschichtsverein Windecken
2000 sitzt in den Startlöchern, um nach gezielten Feldbegehungen
die Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß auf dem
"Tannenkopf" von Fachleuten der Spaten angesetzt wird, um eventuell
Licht in die "Fälscheraffäre" um die Wetterauer
Brandgräber zu bringen. Leider ist das Landesamt für
Denkmalpflege in Wiesbaden seit einem Jahr außer Stande, die
für eine gezielte Suche nach Siedlungsspuren an der Hohen
Straße dringend benötigten archäologischen
Luftaufnahmen zur Verfügung zu stellen.
Der Geschichtsverein Windecken sieht in diesem Unvermögen ein
Armutszeugnis und will sich nun nicht länger hinhalten lassen. Es
könne nicht angehen, so Vorsitzender Rolf Hohmann, daß auf
der einen Seite immer wieder ehrenamtliches Engagement gefordert, auf
der anderen aber gerade dieses durch bürokratische Hemmnisse
konterkariert werde.
|
© Geschichtsverein Windecken
2000
Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Vereins.
|



