In vielen alteingessenen Windecker Familien lebt
die Erinnerung an das Große Kaisermanöver von 1897 fort. Es
müssen aufregende Tage in dem sonst so geruhsamen
Landstädtchen gewesen sein, als im Gefolge des Kaisers Wilhelm II.
deutsche Fürsten und hohe ausländische Gäste sich im
Bannkreis des Wartbaums aufhielten, um von dieser Höhe aus den
Beginn des großen Kriegsspiels zu verfolgen.
Pfarrer Carl Henß hat in seinem Bändchen »Ein historischer Baum im Hanauer Land« (1909) dem Kaisermanöver ein Kapitel gewidmet. Wir zitieren aus der uns vorliegenden Urfassung:
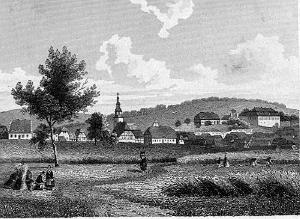 |
| Grossansicht laden | © GVW 2000 |
Blick von der Wartbaumhöhe auf Windecken um 1850. Stahlstich von L. Thümling nach einer Zeichnung von C. Köhler.
Repro: Rolf Hohmann
|
»Den Kriegs- und Friedensbildern, die am Windecker
Wartbäumchen vor unserem Auge aus der Vergangenheit auftauchen,
reihen wir noch eines aus der jüngsten Zeit an, das
Kaisermanöver vom Jahre 1897, das in der militärischen
Geschichte unseres Volkes bisher einzigartig dasteht: war es doch das
erste Mal, daß norddeutsche und süddeutsche Truppen,
Preußen, Hessen und Bayern im Wettstreite miteinander unter den
Augen ihres obersten Kriegsherrn Proben ihrer Leistungsfähigkeit
und Kriegstüchtigkeit ablegten. In den ersten beiden
Manövertagen, am 6. und 7. September, sah der Wartbaum eine Menge
hervorragender Fürstlichkeiten, Heerführern und
fremdherrlichen Offizieren: den Kaiser und die Kaiserin von
Deutschland, den König von Sachsen, den König und die
Königin von Italien, den Großherzog und die
Großherzogin von Hessen, den Prinzregenten Luitpold von Bayern,
den Oberbefehlshaber der bayerischen Truppen Prinzen Leopold, sowie den
Prinzen Rupprecht von Bayern, den Bayerischen Kriegsminister Freiherrn
von Asch, die kommandierenden Generäle des 16. und 11.
preußischen Armeekorps, Grafen von Häseler und von Wittich,
den Großfürsten Nikolaus Nicolajewitsch von Rußland,
ferner Vertreter der russischen, österreichischen,
französischen, englischen, italienischen, türkischen und
sogar japanischen Armee; sie alle haben unter dem Wartbaum gehalten und
seine historischen Erinnerungen um eine der interessantesten
und wertvollsten bereichert. Für die Bayern
besonders, die am 7. September die Höhe des Wartbaums nahmen, war
die Gegend um Hanau, die sie von hier aus übersehen konnten,
historischer Boden: Dort haben ihre Vorfahren unter dem Feldmarschall
Fürsten Wrede mit dem ersten Napoleon gerungen, als dieser durch
die Völkerschlacht bei Leipzig gezwungen wurde, den Weg zum Rhein
zu nehmen«.
Friedel Kurz erinnert sich an das Kaisermanöver
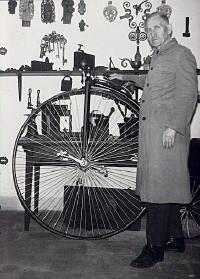 |
| Grossansicht laden | © GVW 2000 |
|
Mechanikermeister Friedel Kurz in hohem Alter
|
Der Windecker Mechanikermeister Friedrich (Friedel) Kurz war von Jugend
auf ein vielseitig interessierter Mann. Er fand als selbständiger
Handwerker genügend Zeit, viele Gedankengänge aufzuzeichnen
und er hinterließ eine beachtliche Anzahl von Gedichten. Friedel
Kurz hatte im Laufe der Zeit zahlreiche Zeitschriften abonniert, die er
alle sammelte. Beginnend von der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg
häuften sich so Berge von bedrucktem Papier an. Diese
Sammelleidenschaft hat sich auf seinen Sohn Heinrich vererbt, der den
schriftlichen Nachlass seines Vaters und seine Sammlung dem
Geschichtsverein Windecken übereignete. Der größte Teil
ist in die 1993 der Stadt Nidderau von Rolf Hohmann gewidmeten
Schenkung eingeordnet worden, die in einem gesonderten Raum im
Nidderauer Rathaus aufbewahrt wird. Nachdem er das 60. Lebensjahr
überschritten hatte, begann Friedel Kurz seine Lebenserinnerungen
nieder zu schreiben. Sie sind allein vom Umfang her und vor allem wegen
ihrer Detailgenauigkeit eine wertvolle Quelle für den
Lokalhistoriker. Friedel Kurz hat als Elfjähriger 1897 das
großer Kaisermanöver mit erlebt und sie in seinen
Lebenserinnerungen nieder geschrieben. Wir veröffentlichen seinen
Erlebnisbericht nachfolgend im Wortlaut:
Das Knattern von tausend Gewehren
»Das Jahr 1897 sah hier das große Kaisermanöver bei
dem das 3. bayrische und 3. preußische Armeekorps aufmarschiert
waren. Die Hauptübungen fanden in unmittelbarer Nähe statt.
Die Herbstferien hatten noch nicht begonnen, da erschienen an einem
Vormittag hinter der Stadt, grad der Schule gegenüber Soldaten.
Dann fuhr die Artillerie auf, über die Äcker hinweg, als ob
da kein Weg sei. Der Lehrer besann sich nicht lange und schickte uns
alle weg. Was hätte auch das Unterrichten noch für einen
Zweck gehabt. Die anderen Klassen hatten es nicht so eilig. An Essen
dachte zunächst keiner der hinausstrebte. Wir kamen bis vor Hanau,
überall eine unübersehbare Masse Soldaten, aber auch
Schlachtenbummler. Im Nu gab es kein Bier, keine Zigaretten mehr. Kein
Metzger, kein Bäcker der noch was Eßbares vorrätig
hatte. Wir aßen Äpfel und brachten diese Frucht unseren
Freunden, den Soldaten, die selbst die Bäume nicht zu
plündern wagten. Wir erlebten Kavallerieattacken, hörten zum
ersten Mal Geschützfeuer und das Knattern von tausend Gewehren.
Wer dachte da noch an die Schule. Am nächsten Tag mußten wir
aber wieder dort erscheinen. Unserem Lehrer, der ein Freigeist war,
wurde sein Verhalten in dieser Angelegenheit krumm genommen. Er freute
sich jedoch mit uns über das Erlebnis.
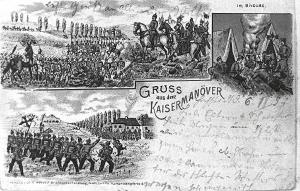 |
| Grossansicht laden | © GVW 2000 |
Motiv-Postkarte vom Kaisermanöver, die am 6.September 1897 vom Postamt Hochstadt abgeschickt wurde.
Repro: Rolf Hohmann
|
Drei Tage ging die Sache gut. Die Bayern hatten die Preußen weit
zurückgetrieben, da kam ein Dauerregen und eine Armee bezog
Notquartiere. Sieben Stunden saß der alte Graf Haeseler auf
seinem Pferd vor dem Rathaus beim Zurückmarsch seiner Truppen im
dicksten Regen. Man sagte, er habe eine silberne Rippe. Ich sah ihn
auch etwas seitlich geduckt auf seinem Pferde sitzen. Das waren
ereignisreiche Wochen für uns Jungen. Wir holten in den Orten wo
man noch etwas kaufen konnte, Zigarren und Branntwein und brachten es
ins Feld zu den Soldaten, die uns das Geld dazu gegeben hatten. Es gab
Magazine in großen Zelten. Die armen Leute hatten auf einmal Brot
genug. Kommißbrote, länglich eckige von den Preußen
und runde, mit Kümmel darin von den Bayern. An den
Biwakplätzen lagen die Konservenbüchsen zu Tausenden am
Boden. Das Fleisch, das in den Erbsen und Bohnen mitgekocht war, hatten
die Soldaten herausgefischt und die Büchsen liegen lassen. Mit
Wagen fuhren sie die Bauern zusammen um sie für die Schweine
auszukochen. Vielen Schweinen bekam das schlecht und sie segneten
vorzeitig das Zeitliche. Die Messinghülsen der Patronen, teils
abgeschossen, teils noch mit den roten Holzstopfen, lagen haufenweise
im Feld herum. Niemand hatte etwas dagegen, daß wir sie sammelten
und als Altmaterial verkauften. Aus den Kanonen waren beim
Abschuß jedesmal ein Bündel etwa 30 cm lange dünne
Holzstäbchen herausgeschleudert worden. Da war es eigentlich
gefährlich beim Schuß vor die Mündung zu geraten. Man
hat jedoch nichts von Unfällen durch diese erfahren.
An vielen Stellen waren Brücken über den Fluß
geschlagen worden und für uns war es ein großes
Vergnügen da hinüberzugelangen. Schließlich geriet ich
mit den Soldaten, zuletzt mit der bayerischen Artillerie, weit ab von
zu Hause. Der Empfang daheim war dann auch danach. Im Herbst half ich
bei dem Müller mit dem elektrischen Licht bei der Kartoffelernte.
Große Strecken Ackerland waren zusammengestampft. Über weite
Strecken zogen die Wege der Infantrieregimenter quer über die
Kartoffel- und Rübenäcker. Fest wie ein Stein waren diese
Spuren. Auch wo sich die Zivilisten aufgestellt hatten brauchte man
kaum noch nach Feldfrüchten zu suchen. Kommissionen schätzten
den Schaden ab und mancher kam bei der Entschädigung auf seine
Kosten, mancher aber nicht.«
So weit die Erlebnisse des elfjährigen Friedel Kurz beim großen Kaisermanöver von 1897.
50 Reichspfennige für die Reinigung eines Gefangenen
In der allgemein zugänglichen Literatur gibt es kaum nähere
Angaben darüber, welche Truppeneinheiten in jenen Septembertagen
des Jahres 1897 im nördlichen Hanauer Land am großen
Manöver teilnahmen und welche Kosten dem Steuerzahler durch dieses
gewaltige Kriegsspiel entstanden.. Die »Windecker Stadt-Kämmerei-Bürger-Kassen-Rechnung für das Etat-Jahr 1897/98«
enthält hierzu nähere Angaben. Alle Vergütungen für
Einquartierungen, Verpflegung, Fouragelieferungen, Vorspanndienste,
Pferdefutter, Stallmieten usw. mußten vom Militär
zunächst an die Stadtkasse überwiesen werden. Die Auszahlung
der genau festgelegten Beträge erfolgte dann durch den
Stadtkämmerer Schmalz. So wurden »Johs. Vollbrecht II und Genossen«
immerhin Verpflegungs- und Quartiergelder in Höhe von 1571
Reichsmark ausbezahlt. Bürgermeister Reul erhielt damals ein
Jahresgehalt von 1275 RM, Stadtkämmerer Schmalz 537 RM und
Stadtschreiber Zimmermann 514 RM. Für geleisteten Vorspann im
Manöver mußten Heinrich Vetter & Genossen 672 RM
vergütet werden. Der Gefangenenaufseher Marschall erhielt
»für die Reinigung eines Gefangenen« 50 Reichspfennige
Aufwandsentschädigung. Bürgermeister Reul und einige
Stadtverordnete stellten für die Abschätzung der
angerichteten Flurschäden 87 RM 75 Pfg in Rechnung. Die Summe der
Einnahmen aus allen Serviceleistungen Windecker Bürger für
die am Kaisermanöver beteiligten Truppen belief sich auf 28.182
Reichsmark und 9 Pfennige.
Folgende Militäreinheiten waren in Windecken einquartiert oder nahmen »Service-Leistungen« in Anspruch:
- 1. reitende Batterie des Hessischen Feldartillerie-Regiments No. 11 in Kassel
- Dragoner-Regiment No. 6,
- 1. Bataillon des thüringischen Infanterie-Regiments No. 32 in Meiningen
- 1. Bataillon des Infanterie-Regiments No. 168
- 2. Bataillon des Infanterie-Regiments No. 166 in Hanau
- Dragoner-Regiment No. 23 in Darmstadt
- 1. Bataillon des Infanterie-Regiments No. 161 in Köln
- 2. Ulanen-Regiment in Ansbach
- 1. Bayerisches Schevanlegers-Regiment
Der Windecker Stadtkämmerer war in gleicher Sache auch für
die dem Großherzogtum Hessen-Darmstadt zugehörige
Nachbargemeinde Heldenbergen zuständig. Hier waren bereits am 14.
und 15. August 1897 Angehörige der 1. fahrenden Batterie des
Regiments-No. 25 einquartiert. Ihnen folgten in den nächsten drei
Wochen unter anderem Soldaten der 5. fahrenden Batterie und das 2.
Bataillon des Regiments No. 11, verschiedene Truppenteile der 37.
Division, des Eisenbahnregiments No. 8, des II. Bayerischen Armeekorps,
des XI. Armeekorps, der 1. fahrenden Batterie des Artillerie-Regiments
No. 25, der 5. fahrenden Batterie des Artillerie-Regiments No. 11 und
des 2. Bataillons des Regiments No. 94.
Allein Georg Goy II. & Konsorten standen für verschiedene
Dienstleistungen und Einquartierungsgelder 961 Reichsmark zu. Die
Gesamtentschädigung der Gemeinde Heldenbergen belief sich auf
113.790,89 Reichsmark. Die Großherzogliche Distriktseinnehmerei
Nieder-Wöllstadt mußte allein 50.601,22 Reichsmark für
die angerichteten Flurschäden an die Gemeindekasse Heldenbergen
überweisen.
Dagegen würde man heute die 40 Reichspfennige, die Michel Braun
»für Docht und Petroleum für die Wache«
ausbezahlt wurden, als Peanuts bezeichnen.
|



