|
Der in der Internet-Zeitschrift "archäologisch" im
vergangenen Jahr veröffentlichte Beitrag "Die
Wetterauer Brandgräber" hat bei dem an der Vorgeschichte des nördlichen
Hanauer Raums interessierten Personenkreis die nie ganz verstummte Diskussion
über diese "Fälscherstory" erneut entfacht. Im Mittelpunkt des
Geschehens stehen die vom gebürtigen Windecker Georg Bausch entdeckten
bandkeramischen Brandgräber. Diese Bestattungsform war in diesem Kulturkreis
unseres Raums bisher noch nicht bekanntgeworden.
Vor allem die vom gelernten Brunnenbauer und seit 1906 für die
Richslimeskommission tätigen Bausch geborgenen durchbohrten Kettenanhänger
aus Main-Kieselsteinen, Schieferplättchen, Tonperlen etc. erregten
bald nach seinem Tod im Jahr 1932 das Mißtrauen einiger Fachleute.
So machte auch Müller-Karpe in seiner 1944 veröffentlichten Abhandlung
"Zur Originalitätsfrage der Wetterauer Brandgräber" zwar einige
Andeutungen in Richtung möglicher Manipulationen, gab aber nach dem
Motto "In dubio pro reo" kein definitives Urteil ab.
Wetterauer Brandgräber eine Massenfälschung ?
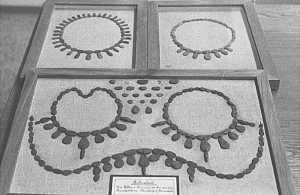 |
| Grossansicht
laden |
© GVW 2000 |
| So werden die erhalten gebliebenen Bausch-Steinketten
im Magazin des Historischen Museums Hanau aufbewahrt. Foto: Rolf Hohmann |
Anders Frau Gudrun Loewe (Neuß), die vor allem aufgrund eines Gutachtens
der Materialprüfungsanstalt der Technischen Hochschule Darmstadt ein
klares "Schuldig" aussprach. In ihrem in der "Germania" 1958 abgedruckten
Beitrag "Zur Frage der Echtheit der jungsteinzeitlichen "Wetterauer Brandgräber"
stellte sie in ihrem Resümee eindeutig fest: "Die in diesem Bericht
vorgetragenen Bedenken haben mich zu der Überzeugung gebracht, daß
die "Wetterauer Brandgräber" nebst ihren Beigaben von Bauschs Hand
herrührten". Und an anderer Stelle: "Die Herstellung der Beigaben
wäre mit den technischen Mitteln der Steinzeit undurchführbar;
es bedarf dazu eines neuzeitlichen Metallbohrers."
Dieses vernichtende Urteil empörte die Enkelkinder (Georg Bausch
hatte acht Kinder), die in Folge bemüht war, ihren Großvater
von diesem Makel zu befreien. Im nördlichen Hanauer Raum hatte Ende
der sechziger und vor allem in den siebziger Jahren der in Windecken ansässige
Amateurarchäologe und Freie Journalist Rolf Hohmann durch die Entdeckung
zahlreicher vor-und frühgeschichtlicher Fundstätten auf sich
aufmerksam gemacht. Als er im August 1972 aufgrund der vom Nidderauer Stadtparlament
beschlossenen Ausweisung von Neubaugebieten "der Not gehorchend" vom damaligen
Hessischen Landesarchäologen offiziell mit Ausgrabungen auf dem Areal
des ehemaligen römischen Erdkastells Heldenbergen beauftragt worden
war, wurde im Regionalfernsehen und Rundfunk sowie in vielen Zeitungen
des Rhein-Main-Gebietes über diese ebenso außergewöhnliche
wie "fundträchtige" Aktion von Laien, ausführlich berichtet.
Dadurch erhielt auch eine in Gießen wohnende Bausch-Enkelin, Kenntnis
von den Aktivitäten Hohmanns im nördlichen Hanauer Raum. In ihrem
vom Kulturamt Hanau an ihn weitergeleitetes Schreiben vom 24. August 1972
gibt sie ihrer Empörung über das von Gudrun Loewe über ihren
Großvater gefällte Fälscher-Urteil unverblümt Ausdruck.
Sie äussert weiter die Hoffnung, daß Rolf Hohmann bei seinen
Ausgrabungen "vielleicht auch eines dieser Brandgräber" finden könnte
und meinte:"Wäre das schön."
Leider erfüllte sich dieser sehnliche Wunsch nicht. Doch die Enkel
des Georg Bausch gaben nicht auf in ihrem Bemühen, den Namen ihres
Großvaters reinzuwaschen. Eine in Erlensee wohnende Enkelin hat Rolf
Hohmann jüngst darum gebeten, aufgrund seiner Erfahrungen und Verbindungen
erneut Nachforschungen in dieser Angelegenheit anzustellen. Ihre 1913 geborene
Mutter habe auch im hohen Alter immer noch nicht die Hoffnung aufgegeben,
dass die ihrem Vater zur Last gelegten Fälschungen von steinzeitlichen
Artefakten von ihm nicht begangen worden sind.
Kann man hundertmal manipulieren ?
 |
| Grossansicht
laden |
© GVW 2000 |
| Diese Steinkette aus Mainkieseln besteht
aus je 34 Gliedern und Anhägern mit insgesamt 136 Bohrungen. Sie ist
mit ungefähr 700 Punktverzierungen versehen. Repro: Rolf Hohmann |
Rolf Hohmann sagte zu, den "Fall Bausch" von einer ganz anderen Seite zu
beleuchten, als vor ihm die Fachwissenschaftler. Er wertete zunächst
alle ihm verfügbaren Quellen aus und bestellte über den Auswärtigen
Leihverkehr der Hanauer Stadtbibliothek, die in Fachzeitschriften und Büchern
darüberhinaus veröffentlichten Abhandlungen über die Wetterauer
Brandgräber. Ihm wurde sehr schnell klar, daß Gudrun Loewe und
andere Autoren seiner Ansicht nach in ihren Betrachtungen über die
Wetterauer Brandgräber den "Zeitfaktor" sträflich vernachlässigt
haben. Rolf Hohmann konzentriert sich bei seinen Recherchen auf die Ausgrabungsperiode
zwischen 1906 - 1910.
Nach der von Gudrun Loewe aufgestellten Tabelle wurden in diesem Zeitraum
von Georg Bausch, vor allem in den Gemarkungen von Butterstadt, Kilianstädten,
Büdesheim und Windecken, 46 Brandgräber entdeckt, mit Kiesel-oder
Schieferanhängern als Beigaben. Nun lebte Georg Bausch damals in Marköbel
mit seiner großen Familie in sehr beengten Verhältnissen. Wie
konnte er unbemerkt innerhalb von vier oder fünf Jahren neben seiner
umfangreichen Tätigkeit als "Reichlimeshilfsforscher" Hunderte von
Anhängern durchbohren und mit Ritz-oder Punktverzierungen versehen?
Im Historischen Museum Hanau werden fünf von Georg Bausch geborgene
Steinketten aufbewahrt. Bisher wurde eine davon etwas näher in Augenschein
genommen. Sie besteht aus 34 Kettengliedern und Anhängern aus Mainkieseln.
Die Glieder sind mit je drei Bohrungen versehen, die Anhänger weisen
jeweils eine Bohrung auf.
Wie lange dauerte es, allein diese 136 Bohrungen mit einem Gerät
zu Beginn des 20. Jahrhunderts herzustellen? Und wo hatte der nicht mit
Reichtümern gesegnete Brunnenbauer Bausch ein Bohrgerät her?
Alle Kettenglieder und-Anhänger sind auf beiden Seiten mit durchschnittlich
zehn Punktverzierungen versehen, also insgesamt etwa 700! Abgesehen davon,
daß die Gräber so präpariert werden mußten, daß
die Fachleute keinen Verdacht schöpfen konnten. Das alles hätte
sehr viel Zeit in Anspruch genommen, ebenso das Beschaffen der ungezählten
Mainkiesel, die es schließlich nicht in einem Baumarkt zu kaufen
gab. Rolf Hohmann hat sich der Mühe unterzogen, in einem Kieswerk
einige Dutzend passender Steine aus einer großen Aufschüttung
herauszuklauben. Eine wahre Sisyphosarbeit!
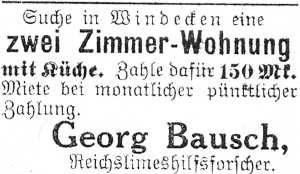 |
| Grossansicht
laden |
© GVW 2000 |
| Anzeige in der Windecker Zeitung vom 20.
November 1909 Repro: Rolf Hohmann |
Auch Walter Gerteis stellte in seinem 1960 herausgegebenen Buch "Das unbekannte
Frankfurt" viele Fragen. Das Kapitel "Der Mann, der Frankfurt 2000 Jahre
älter machte" befasst sich mit den Ausgrabungen von Georg Bausch und
den gegen ihn lange nach seinem Tod erhobenen Verdacht des Fälschens
von Artefakten. Der Autor schreibt: "Man fand im Laufe der Jahre fast hundert
Brandgräber!"
Dr. Loewe bemerkt dazu: "Viele Wissenschaftler sind Zeugen solcher Ausgrabungen
geworden, weil die bis dahin unbekannte Grabform größtes Interesse
weckte und die relativ kleinen Objekte sich gut in einer Schaugrabung vorführen
ließen." Sehen wir davon ab, ob man einen Fachmann wie Professor
Wolff tatsächlich durch anderthalb Jahrzehnte immer und immer wieder
täuschen kann. Es bleibt die Frage: Kann man hundertmal - davon in
etlichen Fällen vor immer neuen Sachverständigen - die gleiche
schwierige Fälschung machen, ohne entdeckt zu werden? Hundertmal!
Um diese Frage kommt man nicht herum. Bejaht man sie, dann gehören
die Wetterauer (und Frankfurter) Brandgräber zu den einmaligen wissenschaftlichen
Irreführungen, gehört der Brunnenbauer Georg Bausch in die Galerie
der Meisterfälscher, wie es nur wenige gegeben hat."
Der getürkte Jupiter von Nidderau
 |
| Grossansicht
laden |
© GVW 2000 |
| Der Hessische Landesarchäologe Prof.
Dr. Helmut Schoppa (rechts) mit Rolf Hohmann am 28. Juli 1972 an der "Urgrabung"
auf dem Kastellgeläde in Heldenbergen. |
Rolf Hohmann ist aufgrund seiner bisherigen Recherchen zu der Überzeugung
gelangt, daß Georg Bausch, sofern Manipulationen stattfanden, das
"Unternehmen Wetterauer Brandgräber" kaum allein hätte durchführen
können. Schon Müller-Karpe äusserte 1944 einen Verdacht
in einer bestimmten Richtung: "Einige heute noch lebende Windecker, mit
denen ich über die Angelegenheit sprach, versicherten übereinstimmend,
dass sie es für ausgeschlossen hielten, dass der alte Bausch die Schmuckbeigaben
der neolithischen Gräber gefälscht habe, einmal wegen seines
im Grunde ehrlichen Charakters, dann aber auch, weil sie ihm die geistige
sowohl wie die technische Fähigkeit nicht zutrauten, die doch zur
Herstellung der Fundgegenstände und ihre Unterbringung in "zurechtgemachten"
Gräbern nötig gewesen wäre. Es bliebe dann allerdings einen
im Hintergrund arbeitenden raffinierten Alterumshändler oder dergl.
anzunehmen, der mit Bausch unter einer Decke gesteckt habe. Von einem solchen
Verkehr wußten aber die gefragten Windecker Einwohner gar nichts."
Rolf Hohmann hatte in seinem Antwortschreiben an die in Gießen lebende
Bausch-Enkelin ausgeführt: "Meine Recherchen hier in Windecken haben
den Verdacht genährt, daß sich Ihr Großvater als Werkzeug
einiger Spaßvögel hat mißbrauchen lassen, die der Fachwelt
aus bisher noch unbekannten Gründen eins auswischen wollten. Das ist
aber nur eine Vermutung."
Rolf Hohmann ist selbst ein "gebranntes Kind" und recherchiert deshalb
in dieser Angelegenheit mit viel Fingerspitzengefühl. Als Leiter
der Ausgrabungen auf dem Kastellgelände in Heldenbergen führte
er genau Protokoll. Am 5. September 1972 notierte er: "Bisher wichtigster
Fund. Terrakotta? Halbmaske eines bärtigen Mannes (Gott?) ohne Beschädigung
im Abschnitt IIa." Finder dieses lehmverkrusteten Artefakts war der eifrigste
Ausgrabungshelfer und der Laie Hohmann schöpfte deshalb zunächst
keinerlei Verdacht; auch wenn sich bis zu diesem Zeitpunkt unter dem umfangreichen
Fundmaterial, ausser zwei oder drei kleinen Terra sigillata-Schälchen,
und einem Öllämpchen, keine unbeschädigte Keramik befand.
In seiner regelmässigen Presseberichterstattung über die Ausgrabung
erwähnte er diesen "Sensationsfund" zunächst jedoch nicht, denn
er wollte erst einmal die Expertise des Landesarchäologen abwarten.
 |
| Grossansicht
laden |
© GVW 2000 |
Der getürkte "Jupiter von Nidderau".
Repro: Rolf Hohmann |
Doch auch dieser erkannte auf Anhieb nicht, dass sich hier ein Spaßvogel
einen Jux machte, und seine erste Bewertung des Fundstücks war so
präzise wie eine Weissagung des Orakels von Delphi. Aufgrund dieser
Ausgangslage erschien im Hanauer Anzeiger am 11. Oktober 1972 ein Foto
des "Jupiter von Nidderau" mit der Unterschrift: "Das ist der wertvollste
Fund, der seit einigen Wochen auf dem Gelände des ehemaligen Erdkastells
im Gang befindlichen Ausgrabungen, die ausschließlich von Amateuren
durchgeführt werden. Die Terrakotta-Maske eines bärtigen Mannes
ist zwölf Zentimeter hoch und bis auf zwei feine Risse unbeschädigt.
Sie wurde in etwa einem Meter Tiefe von dem bisher erfolgreichsten Ausgrabungeshelfer,
Friedel E., aus dem Nidderauer Stadteil Heldenbergen, geborgen.
In der überregionalen Frankfurter Allgemeinen Zeitung wurde der
Fund mit folgendem Text abgebildet: "Für ein Abbild Jupiters hält
Amateurarchäologe Rolf Hohmann aus Nidderau diese zwölf Zentimeter
hohe Terrakotta-Maske eines bärtigen Mannes, den bisher wertvollsten
Fund bei den seit drei Monaten unter seiner Leitung laufenden Ausgrabungen
auf dem Gelände des Römerkastells bei Heldenbergen. Daneben wurden
zentnerweise Tonscherben, darunter viel wertvolle Sigillata, Bronzeschmuck,
Münzen, eine bronzene Standartenspitze, Messer, Lanzen, Gefäße
und viele Mauerreste gefunden."
Doch sehr schnell wurde klar, daß der "getürkte Jupiter von
Nidderau" wahrscheinlich aus einem mediterranen Souvenirladen unserer Tage
stammte und er verschwand deshalb in einer Pappschachtel, um bis zu dieser
Veröffentlichung nie wieder erwähnt zu werden. Der "unehrliche
Finder" hatte sicher eine "klammheimliche Freude" an seinem gelungenen
Coup. Er outete sich später zwar "durch die Blume", bekannte sich
jedoch nie offen zu seinem Schelmenstück. |



