| Wein ist neben Wasser wohl das älteste Getränk, das sich
von Urzeiten bis heute im Wesentlichen unverändert erhalten hat. Wein
war das Getränk der Antike, denn die Herstellung erforderte keinen
allzugroßen Aufwand. Es kann nur vermutet werden, wann und in welcher
Gegend erstmals aus Trauben Wein erzeugt worden ist. Als sicher gilt, daß
nicht in allen Gebieten, in denen Wildreben wuchsen, auch Wein gekeltert
wurde. In der Nähe von Damaskus entdeckten Forscher 1969 eine ungefähr
8000 Jahre alte Traubenpresse. Wie bis ins Tertiär zurückreichende
Fossilien zeigen, war die Urform unserer Weinrebe in ganz Europa, in Nordamerika
und Japan verbreitet. Die den heutigen Reben im wesentlichen gleichenden
Pflanzen, traten erst in den obersten Ablagerungen des Tertiäts auf
und wurden bisher ausschließlich in Griechenland und Italien gefunden.
Die Wildrebe (Vitis vinifera silvestris) trägt kleine blaugefärbte,
säuerlich- herb schmeckende Beeren, die in guten Jahren auch heute
noch in den Auwäldern am Rhein, im Kaukasus, in Bosnien und in manchen
Teilen Österreichs eifrig gesammelt und meist zu medizinischen Zwecken,
aber auch zu Traubenkuchen und ähnlichem verarbeitet werden. Der Ursprung
der Weinbereitung und der Kultur des Weines liegt vermutlich in den an
Wildreben reichen Flußtälern Vorderasiens. Die dort ansässigen
indogermanischen Völkerschaften gelten als Urväter des Weinbaues
und der Weinkultur.
 |
| Grossansicht laden | © GVW 2000 |
|
König Hammurabi (links) überreicht dem Sonnengott Schamasch seine Gesetzestafeln (Codex). In Susa aufgefundener Urkundenstein aus Basalt
Repro: Rolf Hohmann
|
Altägyptische Tempelbilder und assyrische Dokumente lassen darauf
schließen, daß diese Völker bereits um 3500 v.Chr. die
Weinbereitung kannten. In dem nach ihm benannten Codex, einer Sammlung
von Gesetzen und Edikten, des babylonischen Königs Hammurabi (1728-
1686 v. Chr.) steht geschrieben: "Der Wein gehört zu den kostbarsten
Gaben der Erde. So verlangt er Liebe und Respekt." In dem 282 Paragraphen
umfassenden Codex sind auch Vorschriften für die Herstellung und den
Verkauf von Wein enthalten.
Im alten Ägypten hatte der Wein einen hohen Stellenwert, war aber
der Oberschicht vorbehalten. Er wurde den Göttern geopfert und in
der Grabkammer des Pharao Tutenchamun (um 1250 v. Chr.) entdeckte der Archäologe
Howard Carter 36 Weinkrüge. Die Amphoren waren mit Erzeugername, Jahrgang
und Lage gekennzeichnet, wie auf den heutigen Flaschenetiketten üblich.
In der Mitte des 2. Jahrtausends v. Chr. dürfte der Weinbau durch
die Phönizier nach Griechenland gekommen sein. Das bezeugen in der
Nähe der kleinen Ortschaft Orchomenos gefundene Ablagerungen aus der
Zeit von 1700 bis 1500 v.Chr., in denen Kerne der jetzt noch kultivierten
Rebsorten eingeschlossen waren.
Wein erwähnt der Dichter Homer in seinen Epen Ilias und Odyssee
öfter. So wurden die griechischen Belagerer Trojas regelmäßig
aus Thrakien mit Rebensaft beliefert. Den Prunkschild des Achilles schmückte
unter anderem auch die Abildung eines Weingartens. Bereits als Kind erhielt
Odysseus von seinem Vater 50 Weinstöcke zur Pflege anvertraut. Auf
seiner Irrfahrt machte er den einäugigen Zyklopen Polyphem mit Wein
so betrunken, daß er ihn blenden konnte und ihm mit seinen Gefährten
die Flucht gelang. Wahrscheinlich lebte Homer im 9. Jahrhundert v.
Chr.
Der Rebensaft verdrängte den zu jener Zeit vorherrschenden aus
Honig hergestellten Mettrank. Daß in der frühgriechischen Gesetzgebung
Weinbergfrevel genauso geahndet wurde, wie Tempelraub und Mord, weist auf
die damalige Bedeutung der Reben hin. Sich auf den griechischen Gott
des Weins beziehend, schrieb Plato: "Dionysos hat ja den Menschen als heilsames
Mittel gegen den finsteren Ernst des Greisentums die Gabe des Weines geschenkt,
sodaß wir wieder jung werden und allen Schwermut vergessen."
Auch die Römer schätzten den Wein
 |
| Grossansicht laden | © GVW 2000 |
|
Römische Weinstube
Repro: Rolf Hohmann
|
Mit der Kolonisierung der gesamten Mittelmeerregion durch die Griechen,
verbreitete sich dort der Weinbau. In der Mitte des 2. Jahrhunderts v.
Chr. erreichte der griechische Kult des Bakchos (Bacchus) das römische
Kerngebiet. Die in der Toskana ansässigen Etrusker sollen etwa um
600.v.Chr. den ersten Korkverschluß für Amphoren entwickelt
haben. Sie exportierten ihren Wein bis nach Gallien. Der Weingenuß
stand allen Gesellschaftsschichten offen. In Pompeji wurden bisher etwa
200 Weinschenken ausgegraben. Der um 500 v. Chr. geborene antike "Reiseschriftsteller"
Herodot berichtet davon, daß in Süditalien die Reben an Pfählen
hochwachsen, während sie in Kleinasien und Afrika am Boden kriechend
gehalten würden. In der Kaiserzeit erreichte der römische Weinbau
seinen Höhepunkt. Damals war der Weinbau einträglicher als andere
Formen der Bodenbewirtschaftung. Dies führte schließlich dazu,
daß die Apenninen-Halbinsel Getreide einführen mußte.
Die Römer hatten ein Monopol auf den Weinanbau, der allen eroberten
Völkern verboten wurde. Die Aufbewahrung des in besonders präparierten
Gefäßen hergestellten Weins erfolgte in tönernen Amphoren,
aber auch in Schläuchen aus Ziegenfell. Um die durch Luftzutritt entstandenen
unangenehmen Geschmackskomponeten zu überdecken, setzte man dem Wein
bittere Pflanzenteile oder Essenzen zu. Der römische Ackerbauschriftsteller
L. Junius Moderatus Columella verfaßte im 1. nachchristlichen Jahrhundert
das umfangreiche Werk "De res rustica", in dem auch ausführlich auf
den damaligen Stand des Weinanbaus eingegangen wird. In Ravenna war
der Wein teilweise billiger als Wasser. Kaiser Diocletian (245- 313 n.
Chr.) erließ für verschiedene Sorten und Qualitäten Höchstpreisverordnungen.
Die Römer brachten den Rebstock auch nach Germanien. Die Anbaugebiete
lagen ausschließlich auf der linken Rheinseite. Vor allem Kaiser
Probus (232- 282) unterstützte die Nauanlage von Weinbergen
in den besetzten Gebieten nachhaltig. Aus dieser Zeit sind viele Artefakte
bekannt, die mit dem Wein in Beziehung stehen. Beispielsweise Grabbeigaben
in Form von Traubenkernen und Gefäßen mit einschlägigen
Inschriften, Hacken und Winzermesser, Weinfässer und schließlich
auch ein in seiner ursprünglichen Anlageform erhalten gebliebener
römischer Weinberg an der Ahr. Der römische Weinbau an der Mosel
ist durch die Dichtung "Mosella" belegt, in der Deciomus Magnus Ausionius
etwa (310- 395) das Moseltal verherrlicht.
Mönche machten sich um den Weinbau verdient
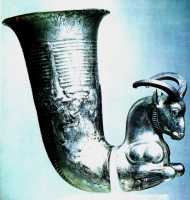 |
| Grossansicht laden | © GVW 2000 |
|
Archämenidisches Trinkhorn (Rhyton) aus Silber. 1. Hälfte des 5. Jahrhunderts v. Chr. Aus der Schimmel-Collection New York
Repro: Rolf Hohmann
|
Nachdem die Römer vor dem Ansturm der Germanenstämme das Feld
geräumt hatten, brachten die unruhigen Zeiten der Völkerwanderung
einen Niedergang des Weinanbaus mit sich. Unter den Karolingern erfolgte
dann eine erhebliche Erweiterung des Weinbaugebietes. Pipin der Kleine
(gest. 768), auch "der Kurze" genannt, verlieh Weinberge oder Flächen
für Neuanlagen. Während es zu dieser Zeit in der Pfalz,
in Rheinhessen, Baden, im Elsaß, dem Neckarraum und in Schwaben bereits
Hunderte von Weinorten gab, scheint der Weinbau den Rheingau erst unter
Karl dem Großen (742- 814) erreicht zu haben. Der Kaiser ließ
große Mengen Rebstöcke aus Burgund nach Deutschland bringen
und errichtete Musterwirtschaften. Die Bedeutung des Weinbaus zu damaliger
Zeit läßt sich daran ermessen, daß Rebfrevel einem Tötungsdelikt
gleichgestellt war. In Mitteldeutschland verbreitete sich der von Kirche
und Fürsten geförderte Weinbau im 9. Jahrhundert ebenfalls.
Unter den Ottonen werden Weinberge in Meißen, Merseburg und Magdeburg
häufig erwähnt. Im 10. Jahrhundert brachten Mönche den Weinbau
nach Sachsen, im 11. Jahrhundert nach Thüringen und im 12. Jahrhundert
nach Brandenburg. Besonders Bendiktinermönche sorgten im Zuge
der Christianisierung im frühen Mittelalter für die Verbreitung
des Weinbaus bis hin nach Litauen und Skandinavien, um die Versorgung mit
Meßwein sicherzustellen.
Kurfürst August von Sachsen (1553- 1556) ließ die Meißener
Hänge und Berge der Lößnitz bei Dresden mit rheinischen
Reben bepflanzen und errichtete zahlreiche Kellereien. Die von ihm in Auftrag
gegebene Weinordnung setzte sein Nachfolger Christian I. (1560- 1591) in
Kraft. Damals führte das Kurfürstentum größere Mengen
Wein aus, doch die Sachsen ließen ihr Eigengewächs auch selbst
gerne durch die Kehlen rinnen.
Als sich der von 1578 bis 1612 regierende deutsche Kaiser Rudolf II.
einst am sächsischen Hof aufhielt, veranstaltete Kurfürst Christian
II. (1583- 1611) ein Wett- Trinken, das der Gastgeber selbst gewann. Er
ging bei einem Besuch in Prag auf diesen bacchanalischen Wettstreit ein
und meinte zum Kaiser gewandt: "Kaiserliche Majestät haben sich gar
trefflich gehalten, daß ich keine Stunde nüchtern war."
Seine größte Ausdehnung mit etwa 350 000 Hektar erreichte
der deutsche Weinbau im 15. und 16. Jahrhundert. An die Güte des Rebensaftes
stellten unsere Vorfahren keine allzugroßen Anforderungen. Er wurde
warm und gesüßt getrunken. Schließlich verdrängten
importierte süffigere Weine aus südlichen Anbaugebieten die "Säuerlinge"
des Nordens.
 |
| Grossansicht laden | © GVW 2000 |
|
Kloster Eberbach im Rheingau. Verwaltung seit 1998 durch eine Stiftung. Der Weinbaubetrieb wurde abgetrennt und wird vom Land Hessen weitergeführt
Repro: Rolf Hohmann
|
Mit viel Eifer und Sachkenntnis nahmen sich die Klöster des Weinbaus
an. Hier soll stellvertretend das Kloster Eberbach im Rheingau Erwähnung
finden. Im Jahr 1136 entsandte der heilige Bernhard Mönche aus, die
einen geeigneten Ort für die Gründung eines Zisterzienserklosters
erkunden sollten. Die Legende erzählt: "Als die ersten Mönche
des Kisselbachtal erreichten, lief ein Eber vom Wald herab, sprang dreimal
über den Kisselbach und soll anschließend mit seinen gewaltigen
Hauern die Umrisse der Abtei eingezeichnet haben." An der Stelle, wo der
Eber den Bach übersprang, wurde die Klosterkirche errichtet und auf
den vom Eber gezeichneten Umrissen die Klostermauern." Damit war der Grundstein
für eine der ältesten und größten Zisterzienser-Abteien
in Deutschand gelegt," heißt es in einer Informationsschrift zur
Geschichte des Klosters. Bereits 1170 bauten Eberbacher Mönche auf
dem Steinberg Wein an, aus dem bis heute ein besonders kostbarer Tropfen
gekeltert wird. Beim Aufstand der Rheingauer Bevölkerung gegen ihren
Landesherren, den Mainzer Erzbischof Albrecht von Brandenburg, im Jahre
1525 wurde auch das Kloster Eberbach geplündert. Die Aufständischen
leerten dabei das große Weinfaß mit einem Fassungsvermögen
von über 71 000 Litern. Nach dem Zweiten Weltkriefg kam das Kloster
in den Besitz des Landes Hessen und die Staatsweingüter übernahmen
die Verwaltung der Weinberge.
Vom Schaffhauser Kriminalwein und der Trülle
Selbst in der klimatisch nicht besonders begünstigten Schweiz wurde
schon früh Wein angebaut. Im Jahre 802 verbot Bischof Remedius Sonntagsarbeit
in den Weinbergen. In Schaffhausen gab es 1145 neben neun Bier auch
zwei Weinschenken. Während Griechen und Römer den Wein mit Wasser
verdünnt tranken, genoß man nördlich der Alpen den Rebensaft
pur und die Obrigkeit achtete streng darauf, daß außer den
genehmigten Verfahren zur Aufarbeitung keine "Schmierereyen" vorkamen.
 |
| Grossansicht laden | © GVW 2000 |
|
Bernkastel an der Mosel ist für seine ausgezeichneten Weinlagen bekannt
Repro: Rolf Hohmann
|
Doch die Geldgier vieler Weinbauern und Händler war stärker
als die angedrohten, teilweise sehr drakonischen Strafen. Als die Weinverfälschungen
weiter überhand nahmen, erließ die Stadt Zürich 1304 strenge
Kontrollvorschriften. Da der in nördlichen Breiten wachsene Wein jeder
"Lieblichkeit" entbehrte, war das "Nachsüßen" weit verbreitet.
Zu jener Zeit stand dafür noch kein Zucker zur Verfügung und
so mußte der recht teure Honig verwendet werden. Ohne Skrupel wurden
von den Weinfälschern vor allem aber das relativ preiswerte, aber
giftige Bleiacetat zugesetzt. Es waren Rezepturen zur Herstellung von Süßstoffkonzentraten
im Umlauf, von denen die Wirte je nach Geschmack des Kunden dem Rebensaft
vor dem Servieren einige Tropfen beimischten. So ein Konzentrat konnte
bis zu 500 Gramm Bleiverbindungen enthalten und viele Zecher trugen nach
dem Genuß derart gesüßter Weine dauerhafte gesundheitliche
Schäden davon.
Die Stadt Schaffhausen reagierte auf das Fälscherunwesen 1393 mit
einem Erlaß, in dem festgelegt war: "Daz niemand keinen win temperiren
sol, der in unser statt verkoffen als vertriben wol." Jeder Bürger
und Landmann habe darauf zu achten, daß er "weder mit gebrenten win
noch mit waideschen noch mit anderen dingen, davon den lüten siechtum,
gebrest und schadt uffersten möchti" hantieren sollte. Wer die Vorschriften
mißachtete, hatte die hohe Geldbuße von zehn Silbermark zu
entrichten und wurde an den Pranger gestellt.
Wasserpanscher führte man mit voller "Wasserbücki" unter Trommelschlag
durch die Straßen zur "Trülle," wie sie auch in Deutschland
zur Bestrafung von Gesetzesübertretern üblich ware. In diesem
vergitterten "Einmann-Karussell" drehten die Geschädigten den Übeltäter
so lange schnell im Kreise, bis diesem speiübel geworden war. Ende
des 15. Jahrhunderts verfügte der Rat der Stadt Schaffhausen: "Jedes
Gewächs soll so belassen werden, wie es an den Rebstöcken gewachsen
ist." Das erwies sich jedoch als frommer Wunsch. Da fast ausschließlich
Weißwein gekeltert wurde und der eingeführte Rotwein teuer war,
tüftelten die Fälscher immer wieder neue Methoden zum "Schönfärben"
aus.
In Schaffhausen erregte 1566 der bis dato größte Weinfälscherskandal
nicht nur die Gemüter der Schweizer. Die fünf Gebrüder Oschwald
führten gemeinsam eine Weinhandlung und waren damit so wohlhabend
geworden, daß sie als die reichsten Bürger der Stadt galten.
Schließlich kam heraus, daß ihr Reichtum nicht ehrlich erworben
wurde, denn das "unsaubere Quintett" hatte über Jahre hinweg billigen
Weißwein durch Zusatz von Vogelbeeren in "Rotwein" verwandelt. Da
dieser Schwindel so lange unentdeckt blieb, mußten die Oschwalds
ihr Fälscherhandwerk gut verstanden haben. Sie atmeten dann gesiebte
Luft und die damaligen rauhen Verhörmethoden sorgten schnell dafür,
daß sie die Namen der Beerenlieferanten und Helfershelfer preisgaben.
Der in ihrem Besitz befindliche "schöngefärbte" Wein wurde beschlagnahmt
und die Stadtknechte kippten ihn von der Rheinbrücke in den Fluß.
Das waren immerhin 535 Saum zu je 167 Liter. Doch dieses Beipiel schreckte
nicht ab. Nur wenige Jahre nach diesem großen Skandal hatte Justizia
schon wieder Beerenlieferanten aus Orten um Schaffhausen am Wickel, weil
sie "Unthrüw, beschiss und trug" begangen hatten. Scherzhaft wurde
der rund um den Rheinfall gekelterte, recht saure Rebensaft, als "Kriminalwein"
bezeichnet.
Der Überlieferung zufolge trichterte man störrischen Kriminellen
einen Liter des "Säuerlings" ein, um ihnen ein Geständnis zu
entlocken. Ganz Hartgesottene bequemten sich erst zur Wahrheit, wenn ihnen
ein zweiter "Einlauf" drohte.
Der Reutlinger Wein frißt ein Loch in den Magen
Auch in vielen deutschen, für den Weinbau ungeeigneten Regionen,
reiften die Trauben zumeist nicht aus. Die Bezeichnung "herb" für
solche Kreszenzen war damals noch nicht erfunden. Zahlreiche Redensarten,
Gedichte und Lieder beschäftigten sich mit diesem Getränk, zu
dem es damals jedoch keine Alternativen gab.
So spottete der bayerische Minister Freiherr von Kreittmayer (1705-
1790): "O glückliches Land, wo der Essig, welcher anderswo mit großer
Mühe bereitet werden muß, von selbst gedeiht." Der Volksmund
dichtete: "In den schlesischen Bergen da wächst ein Wein, der kennt
nicht Hitze und nicht Sonnenschein", oder drastischer: "Der Reutlinger
Wein frißt ein Loch in den Magen, der Tübinger zieht es wieder
zu."
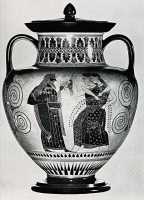 |
| Grossansicht laden | © GVW 2000 |
|
Dionysos und Mänaden. Attische Amphora aus Athen. Um 450 v. Chr. Nationalbibliothek Paris
Repro: Rolf Hohmann
|
In früheren Jahrhunderten drohten Weinfälschern auch von der
deutschen Obrigkeit harte Strafen. Sie dienten jedoch weniger dem Schutz
der Verbraucher, sondern vielmehr zur Schonung der Staatsfinanzen. Mit
dem Wachstum der Städte und der Intensivierung des Handels nahmen
die Betrügereien rasant zu. Bevor Kaiser Katl V. (1500- 1558) mit
der "Peinlichen Gerichtsordnung" die Strafen vereinheitlichte, und die
Fälschung von "gewicht, Specerey oder ander kauffmannschafft" mit
dem Tode ahndete, hatte jede Stadt andere Vorschriften erlassen. Beispielsweise
fanden die Nürnberger nichts dabei, verdorbenes Fleisch an Nachbarstädte
zu verkaufen; wenn ihnen jedoch gefälschte Gewürze angedreht
wurden, verbrannte man die Übeltäter oder begrub sie lebendig.
Im Soester Stadtrecht von 1120 war festgelegt: "Wer faulen Wein mit gutem
Wein mischt, hat sein Leben verwirkt."
Pantschern wurden Stifte durch die Ohren getrieben, man peitschte sie
auch aus oder ließ sie Schanzarbeiten verrichten. An den Folgen von
Bleizusatz im Wein starben 1706 in Stuttgart einige Bürger. Dem "Nachsüßer"
Hanns Jakob Ehrni aus Eßlingen kostete diese Missetat den Kopf.
Wie jüngste Untersuchungen eines Haars des berühmten Komponisten
bewies, starb Ludwig van Beethoven (1770- 1827) ebenfalls an einer Bleivergiftung.
Sie hatte wahrscheinlich aber andere Ursachen, als die Verfälschung
von Wein mit diesem Schwermetall.
Weinmeister mußten einen "leiblichen Eydt" schwören
Die Stadt Hanau liegt fast auf der gleichen geographischen Breite wie
der Rheingau. Wenn auch auf den durch ein mildes Kleinklima und geeignetere
Böden begünstigten Südhängen zwischen Hochheim und
Aßmannshausen die Rebstöcke besser gediehen, wuchs früher
in den Orten der Grafschaft Hanau ein recht passabler Wein. In seiner 1558
erschienenen "Kurtzen Beschreibung der Wetterau" notierte Erasmus Alberus
(um 1500- 1553): "Viel guts Weins wechst im hanauischen Lande."
Anno 1646 bemerkt Matthias Merian (1593- 1650) in seiner "Topographia
Hassia" über das "fast auf die Helffte in der Aschen liegende" Nidderstädtchen
Windecken: "Hatte vorhin auch einen feinen Weinwachs/gute Ackerfelder/auch
Gewälds/unnd dergleichen Nahrunge=Mittel/so aber jetzunter sehr ligt."
Einhundert Jahre später hatte sich der Weinbau vom Niedergang im
Dreißigjährigen Krieg längst wieder er- holt, auch wenn
der Amtsort durch weitere Feindseligkeiten, Einquartierungen und hohe Kontributionen
immer wieder in Mitleidenschaft gezogen wurde. Im "Wetterauer Geographus"
von 1747 heißt es über Windecken unter anderem: "Sonst hat es
um dasige Gegend einen ziemlichen Weinwachs." Damals bewirtschafteten etwa
zwanzig Bürger, vor allem auf dem "Wingert" am Ohlenberg, Weinparzellen
als Nebenerwerb.
 |
| Grossansicht laden | © GVW 2000 |
|
Weinprobe in St. Martin - Gemälde von Richard Platz
Repro: Rolf Hohmann
|
Im ausgehenden Mittelalter muß der Weinbau für das Grafenstädtchen
von größerer wirtschaftlicher Bedeutung gewesen sein. Die jeweils
für ein Jahr gewählten Ober und Unterweinmeister wachten über
die erlassenen Gesetze der Obrigkeit und die den örtlichen Gegebenheiten
angpaßten Verordnungen des Stadtrats. Sie mußten über
Einnahmen und Ausgaben genau Buch führen und waren am Jahresende aus
eigenem Verschulden "Miese" unter dem Strich zu verzeichnen, hatten sie
den Fehlbetrag aus eigener Tasche zu bezahlen. Dieser schöne Brauch
ist leider in Vergessenheit geraten, sonst würden unsere heutigen
Politiker nicht so oft recht sorglos mit Steuergeldern umgehen. Trotz dieses
finanziellen Risikos waren die städtischen Ehrenämter begehrt,
mehrten sie doch das Ansehen der jeweiligen Bürger. Wegen der bestehenden
Regreßpflicht, wurden jedoch nur "Gutbetuchte" berufen.
Vor ihrem Amtsantritt mußten die Weinmeister vor versammeltem
Rat folgenden Eid ablegen: "Ihr sollet geloben und schwöhren, einen
leiblichen Eydt zu Gott dem Allmächtigen, daß Ihr während
dem Euch anvertrauten Weinmeister Ambt dahin eiffrichst besorget seyn wollet,
daß zu Auffnahme der Stadt Wirtschafft weniger nicht der sämbtlichen
Bürgerschafft den Stadtkeller mit gutem tranckbaren Getränck
beleget, solches jedoch auf genaueste Zeith accordiret, und darinnen der
gemeinen Stadt nutzen nach besten Kräfften geprüffet, zu dem
Ende die Weine von Zeith zu Zeith visitiren werden, damit die Euch untergebene
Bendermeister solchen rein und sauber halten, was davon abgegeben oder
vorgelegt wird zum behuff der Herrschafft sowohlen als der Stadt davon
gebührenden accisass genau aufzuzeigen, überhaupt aber Euch also
betragen wollet, wie es einen getreuen Weinmeister gebühret."
Interessantes aus den Weinmeister- Rechnungen
Die älteste im Nidderauer Stadtarchiv aufbewahrte Weinmeister-
Rechnung stammt aus dem Jahr 1475. Für des Rechnungsjahr 1724/25 wurde
der weithin bekannte Windecker Zimmermeister Johann
Georg Baron zum Oberweinmeister gewählt. Er stürzte am 15.
Mai 1725 beim Bau des Ostheimer Kirchturms tödlich ab. Auf dem Titelblatts
der Weinmeister-Rechnung von 1724/25 ist vermerkt: "Geführt von Johann
Georg Baron und nach deßen Hintritt durch Marx Trauten und Jacob
Burckharden." Die Stadt Windecken hatte für den auf ihrem Gebiet erzeugten
Wein das Vorkaufsrecht. Er wurde im Keller der Stadtschenke "Zum rothen
Löwen" am Markt gelagert. In der Weinmeister- Rechnung von 1726 heißt
es: "In dießem Jahr, da ein paar gute Weine gewachsen, haben die
Weinmeister von verschiedenen Bürgern gekauft 17 Ohm und 10 Viertel."
Ohm ist ein altes Bier-und Weinmaß, dessen Volumen in den vielen
Kleinstaaten und größeren Städten unterschiedlich festgelegt
war. Um 1850 hatte die Hanauer Ohm umgerechnet 149,23 Liter, die gebräuchlichere
Frankfurter Ohm 143, 419 Liter. Im 18. Jahrhundert zählte die Ohm
20 Viertel oder 80 große Maß. Aus der Beilage zur Bürgermeister-
Rechnung von 1726 geht hervor, daß damals 22 "Kleinwinzer" der Stadt
Windecken 17 Ohm zum Preis von 166 Gulden lieferten. Die jährliche
Aufwandsentschädigung für den Oberweinmeister betrug vier Gulden,
der Unterweinmeister erhielt zwei Gulden.
Darüberhinaus gab es zahlreiche Nebeneinkümfte in Form von
"Zehrungen," die diese Ämter auch in finanzieller Hinsicht attraktiv
machten. Die Weinmeister- Rechnungen im Stadtarchiv enthalten eine Fülle
von interessanten Eintragungen. Viel ist die Rede von Kriegswirren, wechselnden
Besatzern und geleisteten Kontributionen in Form von Wein. Wurde Windecken
von fremden Truppen heimgesucht, stürmte die Soldateska zumeist gleich
den städtischen Weinkeller, und den Inhalt der Fässer betrachteten
sie als selbstverständliche Kriegsbeute.
Von den Wirren des spanischen Erbfolgekrieges (1701- 1714) war auch
die Grafschaft Hanau betroffen. Die Rechnung des Jahres 1702 erstellten
die Weinmeister Johann Georg Traudt und Michael Schmidt. In der "Specification
des jenigen Weins so durch die Kriegsunruhen mit Gewalt aus dem Vorraths-
Keller weggenommen und heraus geschleppt worden wie folgt" trugen sie ein
"8ten September das hohe aliirte Jäger Corps, so hier gelegen, sich
zurückgezogen und durch die frantzösische Parthey verfolget worden,
als haben gedachte Frey Corps blaue Dragoner dergestalten und unter anderen
Excessen, so sie verübt, in den Wirthskeller mit Gewalt eingebrochen
und 1/2 Ohm 8 Batzen Wein, so eben dem Wirth vorgeleget worden, leer gemacht."
Damals hatte wohl so mancher "blaue Dragoner" seinen Namen in dopppeltem
Sinne zu Recht getragen.
Schützen erhielten Schießwein als Zielwasser
Bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts erfolgte die Besoldung der festangestellten
städtischen Bediensteten neben dem recht dürftigen Jahresgehalt
hauptsächlich in Form von Naturalien; zumeist Bier, Wein, Weck, Käse
und bei besonderen Anlässen auch als komplette Mahlzeiten. Diese "Zehrungen"
bildeten seit dem Bestehen der Stadt Windecken in den Bürgermeister-Rechnungen
den größten Ausgaben-Posten.
In seinem Todesjahr 1437 verlieh Kaiser Siegmund der nunmehrigen Ex-
Residenz der Hanauer Grafen das Privileg, einen Jahrmarkt halten zu dürfen.
Der "Mert", wie er von älteren Windeckern heute noch genannt wird,
bot nun eine willkommene Gelegenheit, die überkommene Sitte der Zehrungen
weiter zu kultivieren. In der von Bernhard Wieker und Henne von Glyburg
"im Jahre des Herrn 1475 bis wieder Sankt Michaelstag 1476" geführten
Bürgermeister- Rechnung wird unter der Rubrik "Ußgifft czerunge"
(Ausgaben für Zehrungen) notiert: "Desgleichen 10 Schillinge und 6
Heller für 23 Maß Wein, als Schultheiß und Bürgermeister
die Wacht dieses Jahr versehen haben zu Weihnachten, Festnacht, zur Kerb
und zum Jahrmarckt, und sie im Harnisch an den Pforten gehütet haben
und in der Stadt umgingen."
Im Jahr 1501 stand dem Stadtknecht "zum Jahrmarkt ein und aus zu läuten"
ein Viertel Wein zu, für die 14 Heller in Rechnung gestellt wurden.
Obwohl es bisher in den Archivalen noch keinen konkreten Hinweis darauf
gibt, fand dieser Jahrmarkt wahrscheinlich im Herbst statt. Er diente nämlich
vor allem dazu, den Einwohnern der Amtsorte Gelegenheit zu geben, ihren
Winterbedarf einzukaufen. Erst zu Beginn des 18. Jahrhunderts gab es dann
auch noch einen Pfingstmarkt. In der Anfangsphase des Dreißigjährigen
Kriegs waren die seit 1288 gehaltenen Wochenmärkte und der Jahrmarkt
noch nicht beinträchtigt. In der Rechnung von 1625/26 notierten die
Weinmeister diesen Ausgabeposten: "4 fl 8s durch etliche Bürger uf
dem Jahrmarkt, welche ufsicht gehalten, verzehrt worden."
 |
| Grossansicht laden | © GVW 2000 |
|
Der heilige Pirminius gründete 724 auf der Insel Reichenau eine Benidiktinerabtei. Die M&oml;nche bauten bereits früh Wein an. Hier ein Weinacker vor der um 900 entstandenen Georgskirche
Repro: Rolf Hohmann
|
Den Schrecken des Krieges verspürten die Windecker erstmals am
10. Dezember 1626, als das zuvor geruhsame Städtchen von einem kaiserlichen
Regiment erstürmt wurde, wobei es einige Verwundete gab. Die wehrfähigen
Männer mußten ständig im Gebrauch von Waffen unterichtet
werden. Wahrscheinlich bildete sich in der Residenzstadt der Herren von
Hanau bereits Mitte des 14. Jahrhunderts eine Gesellschaft der Armbrustschützen.
Im Jahre 1454 gab Graf Philipp der Ältere, geboren 1417 auf Burg Wonnecken,
den Schützen seiner Städte Babenhausen, Hanau und Windecken eine
verbindliche Ordnung. Danach hatten sie zu festgelegten Zeiten Übungen
zu absolvieren, die in Windecken "am Schießberge" stattfanden. Die
Stadt war verpflichtet, den Schützen an den Schießtagen "Zielwasser"
in Form eines bestimmten Quantums Wein zu spendieren, den sogenannten Schießwein.
Nach dem Aufkommen von Feuerwaffen änderte sich an der Schützenordnung
zunächst nichts. Erste Erwähnung finden "Donnerbüchsen"
in der Bürgermeister-Rechnung von 1510/11: "Item haben wir diß
jare den Armbrust und büchßen schützen vor win geben, alß
daß man jeder parthey so sie schißet ein firtel winß
gibt." Die Schützen hatten auch während der Jahrmärkte und
der Kerb Wachdienst zu versehen sowie bei außergewöhnlichen
Anlässen, wie beispielsweise Hinrichtungen, für Ordnung zu sorgen.
Mit dem Weinpfennig die Bildung gefördert
Über den Bau eines repräsentativen steinernen Rathaues mit
Staffelgiebel und einem prächtigen, wappengeschmückten Maßwerkerker,
gibt die Bürgermeister- Rechnung von 1519/20 detailliert Auskunft.
Nach Fertigstellung des Gebäudes, in dem dann auch das Landgericht
tagte, gab es einen zünftigen Richtschmaus. Welche Gaumenfreuden die
Gäste damals erwartete, ist im Abschnitt "Usgift da man den newen
bawe uf dem raidhaws ufgeschlagen hat und gehaben mit den burgern zerung
und anders" genau aufgelistet.
Aufgetragen wurden 129 Pfund wohlzubereitetes Rindfleisch, 14 Pfund
Käse, Geflügel, Fisch, Obst und andere Köstlichkeiten. Schmecken
ließen sich die Gäste auch je eine Ohm Bier und Wein. Der Bau
dieses, für damalige Zeiten imposanten, Rathauses für den Amtsort
mit seinen rund 800 Einwohnern kostete immerhin 364 Gulden. Diese Summe
konnte von der Stadt Windecken nicht allein aufgebracht werden. Sicher
hat damals "gnädigste Herrschafft" tief in die eigene Schatulle gegriffen.
Wie alle Ämter und Städte der Grafschaft mußte auch Windecken
vom Weinschank eine Abgabe an die 1607 gegründete "reformirte Hohe
Landesschule zu Hanau" leisten.
Im "Fürstlich Hessischen- Hanauischen Gnädigst erneuert und
confirmirtes Schul-Patent vom Jahre 1779" wird bestimmt: "Soll in vorbemelten
Städten und Ämtern von jeder Mass Wein, so verschencket wird,
ein Pfennig erhoben und auch die Ohm zu Neunzig Zapf Maas gerechnet, und
aller und jedes Quartal denen Deputirten, oder dem jedesmal verordneten
Erheber richtig eingeliefert werden."
In Windecken kam da schon einiges zusammen, wie aus der Weinmeister-
Rechnung von 1612/13 hervorgeht: "Zur Hanauer Schule Ausgab 52 Gulden 6
Schilling großer Wehrung von 26 Fuder 15 1/2 Viertel." Das Hanauer
Fuder hatte 900 Liter und daran kann man ermessen, welche Mengen Rebensaft
die Windecker Anfang des 17. Jahrhunderts allein in der Stadtschenke durch
die Kehlen rinnen ließen. Für den an seine Gäste ausgeschenkten
Wein erhielt der Stadtwirt den vereinbarten "Zapfferlohn," der im Jahr
1755 für die Maß einen Kreuzer betrug.
Über ein altes Privileg der Weinbauer sind wir durch Eintragungen
in den Weinmeister-Rechnungen informiert. So heißt es beispielsweise
1755: "Die Bürger haben hergebracht, daß sie ihren neuen Wein
von Herbst bis Martini verzapffen dörffen, müssen aber von dem
Wein, so sie verzapffen, die 10te Maas, also von jeder Ohm 8 Maas zahlen,
so halb Gnädigster Herrschaft, halber aber gemeine Stadt bekommt."
Hatte es eine gute Ernte gegeben, profitierten Obrigkeit und die Stadt,
in schlechten Jahren war nichts zu erben. So wie 1716: "...weilen der Wein
nicht gerathen und die wenige Trauben in den Bergen erfroren." Auch 1756
war ein schlechtes Weinjahr und die Weinmeister trugen in die Rechnung
ein: "Einnahme von den Heckenwirten nichts, derweilen es einen späten
Herbst, auch wenig und schlechten Wein gegeben."
Der "Hohenastheimer" verdrängte den Traubenwein
Anfang des 18. Jahrhunderts arteten die als Zehrungen deklarierten Mahlzeiten
der Ratsherren und Ausschußmitglieder zu wahren Gelagen aus. In Absprache
mit den Wirten wurden auch überhöhte Rechnungen ausgestellt.
Der von unabhängigen Rechnungsprüfern aufgedeckte Mißbrauch
führte schließlich dazu, daß nunmehr der Gegenwert der
bisher üblichen Zehrungen als Festbetrag in bar ausgezahlt wurde.
In der Bürgermeister-Rechnung von 1740 heißt es: "Anstatt der
bishero bey bei der Amtsbestellung gehaltenen Mahlzeit ist an Amtmann,
Stadtschreiber und 12 Rathsmitglieder gewöhnermaßen zahlt worden
12 Gulden," und an anderer Stelle: "Denen 22 Rathspersonen an statt des
sonst frey genossenen Kesels bier 12 Gulden."
Nachdem mit dem Westfälischen Frieden das drei Jahrzehnte währende
Morden und Plündern endlich aufgehört hatte, zögerten die
Windecker Weinparzellen- Besitzer nicht lange, um die zum Teil verwilderten
Rebstöcke im Wingert wieder zu rekultivieren und neue anzupflanzen.
Der Handel kam zwar nur zögerlich wieder in Gang, doch bereits 1651
erhielt der Stadtknecht "vom Jahrmarckt ein und außzuleuthen" 7 Schillinge
und 2 Pfennige für eine Maß Wein und einen Weck. Die gleiche
Zehrung stand "zwey Persohnen so bey dem Jahrmarckt die Wag zu versehen"
zu und "Item den Marckt Meistern a 3 maß Wein zahlet, alß sie
das Standt geld ufgehoben," also von den Kaufleuten eintrieben.
Bis etwa zur Mitte des 18. Jahrhunderts war der aus Trauben gekelterte
Wein das bevorzugte Getränk der breiten Bevölkerung. So wurden
1744 allein aus dem Stadtkeller rund 36 Ohm an die Wirte der beiden Stadtschenken
"Zum roten Löwen" und "Zum Mohren" am Ostheimer Tor (existierte nur
einige Jahrzehnte) zum "Verzapffen" ausgegeben. Die Wirte bezogen jedoch
auf eigene Rechnung erhebliche Mengen Wein von auswärts; auch aus
dem Rheingau.
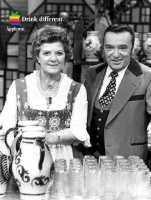 |
| Grossansicht laden | © GVW 2000 |
|
Der Apfelweinkultur wird auch unter Frankfurter Informatikern ausgiebigst gehuldigt.
|
Der "neumodische" Apfelwein konnte sich in unserer Gegend zunächst
nicht durchsetzen, obwohl er erheblich billiger war. Auch im guten Obstjahr
1743 rannen nur rund 200 Liter "Hohenastheimer" durch die Kehlen der Windecker.
Dieses alkoholische Getränk fand schließlich immer mehr Freunde
und die Landwirte reagierten schnell auf den sich immer stärker abzeichnenden
Trend. Sie bauten auf größeren Flächen Apfelbäume
an, die weniger Pflege benötigten als Rebstöcke, gegen Witterungseinflüße
unempfindlicher waren und zudem einen besseren Ertrag abwarfen.
Das Aus für den Weinbau auf dem Wingert kam dann ziemlich schnell,
wie aus der Bürgermeister- Rechnung von 1775 hervorgeht. Dort wird
unter der Rubrik "Vom Weinschank aus der Weinmeisterey" notiert: "Fällt
weg weil kein Weinbau mehr ist und cehsirt diese Rubrik in Zukunft." Die
letzten bekannten Weinmeister der Stadt Windecken waren Johann Conrad Hochstadt
und Friedrich Muth, die 1763 auch die letzte Rechnung erstellten. Zum Abschluß
dieses Kapitels noch ein Kuriosum aus heutiger Sicht: Jahrhunderte hindurch
erhielten die Schulkinder des Grafenstädtchens zur Fassenacht neben
dem obligatorischen Weck auch ein nicht näher angegebenes Quantum
Wein gereicht.
Weinpanscher gab es zu allen Zeiten
Das Weinpanschen aus purer Gewinnsucht ist so alt, wie der Anbau der
Reben. Schon der Prophet Jesaja klagt: "Dein Silber ist Schlacke geworden
und dein Wein mit Wasser verfälscht." Während Griechen und Römer
den ohnehin milden südländischen Wein mit Honig süßten
und mit Wasser verdünnt tranken, ließen ihn die Bewohner jenseits
der Alpen pur durch die Kehlen rinnen.
Um die hier angebotenen "herben" Kreszenzen geschmacklich zu verbessern,
entwickelten die "Schmierer" ebensoviel Methoden, wie es Rebsorten gab.
Dabei verwendeten die Weinverfälscher oft genug auch Stoffe, die gesundheitliche
Schäden verursachten, nicht selten auch zum Tod von fröhlichen
Zechern führten. Immer wieder erließ die jeweilige Obrigkeit
neue Gesetze, um diesem Unwesen ein Ende zu bereiten. Doch alle angedrohten,
auch noch so drakonische Strafen, blieben bis in unsere Tage letztlich
wirkungslos. Allen Freunden des Rebensaftes ist wohl noch der "Glykol-Skandal"
Mitte der 80er Jahre in schlechter Erinnerung. Österreichische Winzer
hatten Weine mit dem giftigen Frostschutzmittel Diäthylenglykol
gepanscht, um sie zu versüßen und zu veredeln. Auch deutsche
Panscher wurden entlarvt.
In seinem Werk "Hanau Stadt und Land" zitiert Ernst.J. Zimmermann ein
am 12. November 1750 nach einem Prozeß gegen Weinfälscher ergangenes
Urteil: "Nachdem die auf Serenissimi unseres gnädigten Fürsten
und Herrn Hochfürstliche Durchlaucht höchst venèrirlichen
Befehl eine Zeit hero vorgesenene rechtliche Untersuchung derer von verschiedenen
gewinnsüchtigen Juden verübten betrügerischen und verderblichen,
mithin höchst strafbaren Weinverfälschungen nunmehr vollendet
worden, so hat man anheute sämtlichen Inquisiten das ihnen gerechtest
ausgesprochen Urteil vor dem auf dem Altstädter Marktplatz hierselbsten
öffentlich versamlet und gehegten peinlichen Gerichts nicht nur publiciret,
sondern auch die solcher betriebenen schändlichen unerlaubten Betrügerei
und gottlose Kunst halber einem jeden zu seiner eigenen Besserung, nicht
weniger als anderen zur Abscheu und Exempel, folglich zur Sicherstellung
des Publici im Handel und Wandel wohlverdiente ansehnliche Geldstrafen,
wie auch respective ewige Landesverweisung, Weinverschüttung und Confiscation
zum Teil wirklich vollzogen."
Es muß sich damals um einen regelrechten Weinfälscherring
gehandelt haben, denn dreizehn Angeklagte erhielten eine Geldstraße
von zuammen 33 050 Gulden. Allein Joseph Nathan mußte 10 000 Gulden
zahlen und Ancel Marx 7000 Gulden. Beide wurden zudem "auf
ewig relegiert." Löb Binge zahlte zwar nur 800 Gulden, ihm wurde jedoch
der Schutz aufgekündigt. Am billigsten kamen Marx Löw Erben mit
150 Gulden davon. Um eine Vergleichszahl zu haben: Die Gesamteinnahmen
der Stadt Windecken betrugen im Jahr 1751 rund 3000 Gulden und die Ausgaben
2900 Gulden. Die verhängten hohen Geldstrafen verdeutlichen aber auch,
welchen ungeheuren Reichtum anzuhäufen unehrenhafte Händler damals
in der Lage waren.
Weinverfälscher endeten ohne Gnade am Galgen
Zu jener Zeit muß das Verfälschen von Wein durch teilweise
höchst gesundheitsgefährdende Stoffe, das "Schönen" und
Panschen eine so große Unruhe bei den "Untertanen" hervorgerufen
haben, daß sich Landgraf Wilhelm von Hessen auf Drängen seiner
Minister veranlaßt sah, den Übeltätern harte Strafen anzudrohen.
 |
| Grossansicht laden | © GVW 2000 |
|
"Edle Weine, klug genossen, haben niemand je verdrossen" - Faß im Keller des Weingutes Schweickhardt & Sohn
Repro: Rolf Hohmann
|
Am 5. Januar 1751 erließ er die "Gnädigste Verordnung die
Bestraffung derer Weinverfälscher betreffend" mit folgendem Wortlaut:
"Von Gottes Gnaden, Wir Wilhem, Landgraf zu Hessen, Graff zu Catzenelnbogen,
Dietz, Ziegenhayn, Nidda, Schaumburg und Hanau rügen jedermänniglich
in Unserer Graffschafft Hanau hier mit zu wissen und ist allenthalben bereits
mehr als viel, bekandt; Was maßen das in den ältesten Reichs-Gesetzen
Anno 1497. und hernach höchst verpönte Wein-und Gifft- mischen
seit einiger Zeit in mancherley Weise und Gestalt hin und wieder von neuem
überhand genommen und von gewinnsüchtigen und ehr- vergessenen
Leuten vielen Menschen durch gemachte Weine an Leben und Gesundheit ein
unersetzlicher Schade zugefügt, und grosse Betrügereyen damit
getrieben worden. Nachdem Wir nun sothane Unwesen vorzeubeugen und dadurch
Unseren getreuen Unterthanen bevorstehende Gefahr so viel thunlich abzuwenden
eine Nothdurfft ermessen; So setzen, ordnen und wollen Wir hiermit, daß
diejenige, welche die Weine mit Mineralien, Silberglett und dergleichen
zu vergiften und schädlich und ungesund zu machen sich unterfangen,
ohne einige Gnade mit dem Strang vom Leben zum Tod gebracht, diejenige
aber, so die Verfälschung mit Vegetalien, Rosinen und Zucker verüben,
ausgepeitschet und auff ewig des Landes verwiesen, auch die Helffers- Helffer,
welche Handreichung darzu thun, oder nur Wissenschaft davon haben, und
solches der Obrigkeit nicht anzeigen, vor ewig mit dem Zuchthauß
oder anderem Gefängnüß gestrafft. Und damit man dergleichen
schädliche Betrügerey desto leichter in Erfahrung bringen könne,
nicht nur bey denen mit Mineralien verfälschten Weinen erfundene Probe
zu jedermanns Wissenschaft und Gebrauch dieser Unserer Verordnung angefügt,
sondern auch hinführo in Unseren Landen bey Ablassung und Pflegung
derer Weine keine andere als zünfftige Bendermeister gebraucht, diese
aber nebst ihren Gesellen durch einen besonderen Eyd dahin verpflichtet
werden sollen, darauf mit Acht zu haben, daß mit denen Weinen durchaus
keine Schmiererey vorgenommen, sondern selbige so pur und reine wie sie
gewachsen, gelassen werden mögen. Wornach sich also ein jeder zu achten
und vor Schaden und Beschimpffungen zu hüten hat; Und damit sich niemand
mit der Unwissenheit zu entschuldigen haben möge: So soll diß
Gesetz und Verordnung durch öffentlichen Glockenschlag zu jedermanns
Nachricht verkündigt, auch jährlich von der Cantzel abgelesen
und an den gewöhnlichen Orten affigieret, auch von Unserer Regierung,
Ober und Nieder-Beambten männiglich darüber gehalten, und auff
deren Contravention genaue Obacht genommen, auch demjenigen, welcher einen
Contravenienten ausmachen und anzeigen wird, mit Verschweigung seines Nahmens
ein besonderes Recompens gegeben werden. Uhrkundlich Unserer eigenhändigen
Unterschrifft und beygedruckten Fürstlichen Secret-Insiegels. So geschehen,
Cassel, 5. Jan. 1751."
Der Würtembergische Liquor probatorius entlarvte Fälscher
Mit der Verordnung wurde auch die "erfundene Probe" veröffentlicht,
deren Gebrauchsanleitung folgenden Wortlaut hat: "Der zur Entdeckung derer
mit Mineralien verfälschten Weine dienende Würtenbergische Liquor
probatorius wird praepariret und gebrauchet, wie folget: Man nimmt von
Auri- Pigment, je hellscheinend und gläntzender je besser solcher
ist, ein Loth, sodann ungelöschten und und zerfallenen Kalck, je frischer
je besser, zwey Loth, pulverisiert solches jedes besonders, thut beydes
in ein Glaß, giesset darüber frisches Brunnen- Wasser zwantzig
Loth, verbindet das Glaß und lässet alles zusamen zweymal 24
Stunden in einer Digestion oder in gelinder Wärme stehen, schüttelt
aber während der Zeit alles öffters unter einander, hernach lässet
man die Liquorem durch ein Fließ- Papier lauffen, so wird derselbe
hell und klar wie Brunen- Wasser."
Das Lot(h) war seit alters her in deutschen Landen die gebräuchlichste
kleine Handels- Gewichtseinheit, die besonders im Münzwesen von Bedeutung
war. Jedes der vielen "Ländle"hatte seine eigenes Lot und damals wäre
ein moderner Computer sicher von großem Nutzen gewesen. Umgerechnet
galt in Bayern bereits seit 811 das Lot zu 17,5 Gramm, in Frankfurt 1858
zu 15,625 Gramm, in Preußen vor 1806 zu 14,606 Gramm, im Großherzogtum
Hessen-Darmstadt vor 1818 zu 16,667 Gramm und danach zu 14,616 Gramm.
Weiter zur Anwendung des "Liquor probatorius", der nun "klar wie Brunen-
Wasser" zum Aufspüren von Weinpanschern einsatzbereit ist: "Von diesem
Liquore lässt man in ein spitz Glaß voll Wein, welcher probiret
werden soll, 8. biß 10. Tropffen fallen, rühret solches
mit einem Höltzlein oder Feder spuhl wohl untereinander, und hat darbey
auf die Veränderung der Farbe des Weins wohl Achtung zu geben: Gestalten,
wann hierauff die Farbe in das Eyer- gelbe fället, und der Wein nach
und nach wiederum helle wird, solches ein gewisses Merckmahl ist, daß
derselbe mit Metallischer und Saturnischer Materie nicht adulteriret, sondern
hiervon rein und pur seye. Daferner aber der Wein auff solches Eintröffeln
und Umrühren rothbraun oder schwärtzlich wird; So ist es ein
untrügliches Zeichen, daß derselbe mit ein oder anderer von
vorgedachten Materialien verfälschet seye. Dieser Liquor gibt einen
überaus schwefelichten und stinckenden Geruch sowohlen in der Praeparaition
als bey dem würcklichen Gebrauch und Application von sich, welcher
der Brust, dem Kopff und denen Lebens-Geistern, wann davon zu viel eingezogen
wird, sehr schädlich ist; Dahero ist dabey alle Behutsamkeit zu gebrauchen
und sonderlich dahin zu sehen, daß man nicht in kleinen und beschlossenen
Zimmern damit viel umgehe, sondern allzeit ein oder mehrere Fenster dabey
eröffne und die Lufft durchstreichen lasse; Es ist auch dieser volatilische
Liquor als ein sonderbares Gifft nicht allein an einem verschlossenen Ort
sorgfältig zu verwahren, sondern auch in einem mit Blasen wohl verbundenen
guten Glaß vor der äußerlichen Luft zu beschützen,
damit er desto länger bey seiner Krafft bleiben, mithin die erforderliche
Würckung verrichten möge; Inmassen derselbe zu Entdeckung derer
Mineralitt verschiedene Wochen und Monathe lang zwaren gut bleiben kan,
gleichwohlen aber doch nicht zu widersprechen ist, daß je frischer
der Liquor, je augenscheinlicher und leichter auch damit die litharyrisirtre
oder ex familia Saturni, das ist aus Bley gehenden Stücken inficirte
Weine auff das richtigste und sicherste verrathen und entdecket werden
können."
Wo bekommt man "frisch Brunen- Wasser" her ?
Sicher könnte auch 250 Jahre später Freunden eines naturreinen
Rebensaftes zugemutet werden, in einem mit Blasen wohlverbundenen guten
Glaß", den vielleicht unter Mitwirkung der Frau Gemahlin im Badezimmer
angesetzten "Würtenbergischen Liquor" und ein "Höltzlein" mitzuführen,
um die Qualität des vom Kellner servierten Weins auf verbotene Zutaten
zu testen. Auch würde wohl ein freundlicher Weinhausbesitzer auf höfliches
Ersuchen des Gastes bereit sein "ein oder mehrere Fenster" zu öffnen,
um den bei "würcklichem Gebrauch" des Liquors entstehenden "schwefeligen
und stinkenden Geruch" abziehen zu lassen - doch wo bekommt man heute
in unseren Breiten die zur Herstellung der Mixtur benötigten "zwantzig
Loth frisch Brunen-Wasser" her ?
- Anhang -
Zitate rund um den Rebensaft
In der Antike spielte der Wein nicht nur als Nahrungs-und Genußmittel
für breite Bevölkerungsschichten eine große Rolle, sondern
er wurde auch als Heilmittel verwendet und diente kultischen Zwecken. Nach
dem Thema Nummer eins, die Liebe, nimmt der Wein im Zitatenschatz
der Völker unangefochten Platz zwei ein. Schon Homer erkannte:
"Denn der Wein erneuert die Kraft ermüdeter Männer."
Der um 600 v.Chr. auf Lesbos lebende lyrische Dichter Akaios prägte
die vielzitierten Worte: "Im Wein liegt Wahrheit" (lat.: In vino veritas)
und wer kennt nicht den Martin Luther zugeschriebenen Spruch: "Wer nicht
liebt Wein, Weib und Gesang, der bleibt ein Narr sein Leben lang." Der
Reformator behauptete auch: "Bier ist Menschenwerk, Wein aber ist von Gott."
Ähnlich der Dichter Victor Hugo (1802-1885): "Gott schuf nur das Wasser,
aber der Mensch schuf den Wein."
 |
| Grossansicht laden | © GVW 2000 |
|
Kunstschmiedeeisernes Aushängeschild der Weinkellerei Schweickhardt & Sohn
Repro: Rolf Hohmann
|
Der chinesische Philosoph und Religionslehrer Konfuzius (551- 478 v.
Chr.) stellte fest: "Am Rausch ist nicht der Wein schuld, sondern der Trinker."
Auch Hippokrates (um 460- 377 v.Chr.), der berühmteste Arzt des Altertums,
mahnte: "Der Wein ist ein Ding, in wunderbarrer Weise für den Menschen
geeignet, vorausgesetzt, daß er bei guter und schlechter Gesundheit
sinnvoll und in rechtem Maße verwandt wird." Der griechische Schriftsteller
Plutarch (etwa 40- 120. n.Chr.) meinte: "Der Wein ist unter den Getränken
das Nützlichste, unter den Arzneien das Schmackhafteste und unter
den Lebensmitteln das Angenehmste" und von seinem römischen Kollegen
Plinius (23-79 n.Ch.) ist folgendes Zitat überliefert: "Der Nutzen
des Weins kann der Kraft der Götter gleichgesetzt werden."
Der Volksmund reimt: "Wird einer früh vom Tod betroffen, heißt's
gleich, der hat sich tot gesoffen. Ist's einer von den guten Alten, dann
heißt's gleich: Den hat der Wein erhalten." Der berühmte Chemiker
Louis Pasteur (1822-1895) behauptete: "Der Wein kann mit Recht als das
gesündeste und hygienischste Getränk bezeichnet werden." Tatsächlich
haben neueste Forschungen ergeben, daß in Maßen regelmäßig
genossener Rotwein vorbeugend gegen Herzinfarkt wirkt.
Dichter und Denker schätzten einen guten Tropfen
Bekanntermaßen war unser Dichterfürst Johann Wolfgang von
Goethe (1749- 1832) ein großen Freund besonders des Frankenweins
und er prägte neben vielen anderen diese Weisheit: "Der Wein erfreut
des Menschen Herz, und die Freudigkeit ist die Mutter aller Tugenden."
Doch er war auch dem "schwachen Geschlecht" sehr zugetan und verband beide
Leidenschaften mit dieser Erkenntnis: "Ein Mädchen und ein Gläschen
Wein kurieren alle Not" und recht drastisch: "Ohne Wein und ohne Weiber,
hol' der Teufel uns're Leiber!" In Auerbachs Keller läßt er
Faust ausrufen: "Es lebe die Freiheit! Es lebe der Wein!" und aus seinem
Westöstlichen Divan stammt diese Weisheit: "Für Sorgen sorgt
das liebe Leben. Und Sorgenbrecher sind die Reben." Und noch ein kleines
Gedicht vom Geheimrat: "Ein Mädchen und ein Gläschen Wein, sind
die Retter in der Not, denn wer nicht trinkt und wer nicht küßt,
der ist so gut wie tot."
 |
| Grossansicht laden | © GVW 2000 |
|
Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang. Selbstbildnis von Rembrandt mit Saskia (um 1634)
|
Auch Wilhelm Busch (1832 - 1908) schätzte einen guten Tropfen
und seiner Erkennnis "Rotwein ist für alte Knaben eine von den
besten Gaben" kann der Autor dieses Beitrag aus vollem Herzen beipflichten.
Vom Schöpfer des "Max und Moritz" stammt auch folgender Spruch: "Wer
als Wein und Weiberhasser jedermann im Wege steht, der esse Brot und trinke
Wasser bis er daran zugrunde geht." Schaut man sich die einschlägigen
Zitatensammlungen genauer an so ist offensichtlich, daß sich viele
Dichter und Schriftsteller vom Rebensaft inspirieren ließen: "Der
Wein ist die edelste Verköperung des Naturgeistes" (Friedrich Hebbel),
"Ich gebe zu, ein Kuß ist süß. Doch süßer ist
der Wein" (Ludwig Hölty, Lyriker), "Der Wein macht das Gehirn sinnig,
schnell und erfinderisch, voll von lebenden, feurigen und ergötzlichen
Bildern" (Shakespeare), "Weißt Du, manchmal habe ich so das Gefühl,
eine Pulle Wein sei mehr Wert, als die ganze Dichterei" (Gottfried Keller),
"Was ist des Lebens höchste Lust? Die Liebe und der Wein" (Joachim
Perinet), "Der Wein wirkt stärkend auf den Geisteszustand, den er
vorfindet; Er macht die Dummen dümmer, die Klugen klüger" (Jean
Paul), "Wein ist Poesie in Flaschen" (Robert Louis Stevenson), "Wundervoll
ist Bacchus' Gabe, Balsam fürs zerrißne Herz" (Friedrich von
Schiller), schließlich noch "Schade, daß man Wein nicht
streicheln kann" (Kurt Tucholsky).
Doch auch große Politiker bekannten ihre Vorliebe für den
Rebensaft. Theodor Heuß schrieb in seiner Dissertation: "Wein ist
der befeuernde Geist aller Feste und der König aller Getränke"
und von dem Schwaben stammt auch dieser Trinkspruch: "Wein saufen ist Sünde,
Wein trinken ist beten. Lasset uns beten." Zum Schluß dieses Zitatenstreifzugs
soll noch die rheinische Frohnatur Konrad Adenauer zu Wort kommen: "Ein
guter Wein ist geeignet, den Verstand zu wecken."
Der Wein im Alten und Neuen Testament
Nach dem Alten Testament war Palästina für seine Reben berühmt.
Die Bibel beschäftigt sich in über 500 Textstellen mit dem Wein
und dessen Anbau. Die erste Erwähnung findet er in der Genesis: "Noah
aber, der Ackermann, pflanzte als erster einen Weinberg. Und da er von
dem Wein trank, ward er trunken und lag im Zelt aufgedeckt" (1. Mose 9.20-
21). Moses erließ zahlreiche Gesetze für den Weinbau. So hatte
ein Winzer das Recht, den Kriegsdienst zu verweigern. "Der Wein erfreue
des Menschen Herz", heißt es im Psalm 104,15, aber Jesaja (5,11)
mahnt: "Weh denen, die des Morgens früh auf sind, dem Saufen nachzugehen,
und sitzen bis in die Nacht, dass sie der Wein erhitzt."
Dieser alttestamentarische Prophet hat sich viel mit dem Anbau und der
Verarbeitung der Reben befaßt. So berichtetet er: "Mein Freund hat
einen Weinberg auf einer fetten Höhe. Und er grub ihn und entsteinte
ihn und pflanzte darin edle Reben (5,1-2). Im "Hohelied" des Salomo heißt
es: "Er küsse mich mit dem Kusse seines Mundes, denn deine Liebe ist
lieblicher als Wein." Von Jesus Sirach (geb. um 200 v.Chr.) sind viele
"Weinsprüche" überliefert. Hier nur einige Beispiele: "Was ist
das Leben, da kein Wein ist?" (31,33), "Zum Wasser des Lebens wird der
Wein dem Menschen, wenn er ihn mit rechtem Maße trinkt" (31,27),
"Der Wein ist geschaffen, daß er die Menschen soll fröhlich
machen" (31,34) und "Dem Toren stellt der Wein manche Falle"(31,30).
 |
| Grossansicht laden | © GVW 2000 |
|
Das letzte Abendmahl von Leonardo da Vinci (1452-1519). Wandmalerei in der Dominikanerkirche Maria delle Grazie Mailand vor der Restaurierung
|
Da die auf den Wein bezogenen Zitate aus dem Neuen Testament zum großen
Teil in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen sind, wird hier
auf eine auszugsweise Wiedergabe verzichtet. Wegen der Bedeutung für
die Christenheit soll aber ein Passus aus dem 26. Kapitel des Matthäus-
Evangeliums zitiert werden, wie er in einer 1764 im Hanauer Waisenhaus
gedruckten Bibel steht: " Da sie aber assen, nahm Jesus das brodt, danckete
und brachs, und gabs den jüngern, und sprach: Nehmet, esset; Das ist
mein Leib. Und er nahm den kelch, und danckete, gab ihnen den, und sprach:
Trinket alle daraus; Das ist mein blut des neuen testaments, welches vergossen
wird für viele, zur vergebung der sünden. Ich sage euch: Ich
werde von nun an nicht mehr von diesem gewächs des weinstocks trincken,
bis an den tag, da ichs neu trincken werde mit euch in meines vaters reich."
Leonardi da Vinci hat "Das letzte Abendmahl" in unerreichter Form als Wandgemälde
verewigt. Abschließend noch eine Weisheit des Kirchenlehrers Augustins
(354- 430 . n. Chr.): "Der Mensch braucht den Wein. Er stärkt den
schwachen Magen, erfrischt die ermatteten Kräfte, heilt die Wunden
an Leib und Seele, verscheucht Trübsal und Traurigkeit, verjagt die
Müdigkeit der Seele, bringt Freude und entfacht unter Freunden die
Lust am Gespräch." |



