Von Ostheim kommend, fließt langsam und behäbig mitten durch
Windecken die "Katzebach", ein kleines, unscheinbares Bächlein mit
kaum zwanzig Zentimeter Wasserhöhe auf zwei Meter Breite, das, ehe
es die Windecker Stadtgrenze erreicht, den Namen "Mühlgraben" führt.
Es gibt viele Deutungen für den Namen "Katzebach", die aber zum Teil
recht abteuerlich oder ziemlich an den Haaren herbeigezogen sind. Deshalb
soll auf diese Erklärungsversuche nicht näher eingegangen werden.
Wessen Ohr aber an der Bezeichnung "Katzebach" Anstoß nimmt, der
sollte eher "Katzenbach" sagen als "Katzbach", weil das Windecker Wässerchen
noch nie so hieß.
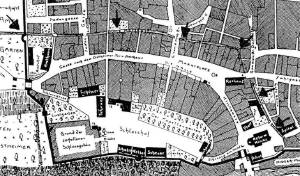 |
| Grossansicht
laden |
© GVW 2000 |
Der von Ernst.J. Zimmermann nach Archivunterlagen
gezeichnete Plan der Stadt Windecken vom Jahre 1727 zeigte den genauen
Verlauf der "Katzebach" durch das Städtchen. Nach Unterqueren der
Stadtmauer etwa in der Mitte zwischen Juden- und Ostheimer Tor floß
er nach Westen und bog dann in der Höhe des Rathauses fast rechtwinklig
nach Norden ab. Direkt am Hospital vorbei fließend mündete "die
Bach" schließlich unmittelbar hinter der Mühle am Heldenberger
Tor in die Nidder.
Siehe auch: Plan
der Stadt Windecken
Repro: Rolf Hohmann |
Ich selbst führe den Namen zurück auf das langsame, katzenartige
Schleichen seines Wassers und nenne sie nach Windecker Art "die Katzebach."
Aber warum "die" Bach ? In der Schriftsprache heißt es doch "der"
Bach ! Vor Luther sagte man in ganz Mitteldeutschland "die" Bach. Erst
mit der Bibelübersetzung bürgerte sich bei dem Worte Bach das
männliche Geschlechtswort ein. In der hiesigen Gegend aber hielt man
am weiblichen Geschlechtswort fest und sagte nach wie vor "die Bach" und
"die Katzebach" und für den Nidderarm der sich am Wehr in der Nähe
der Niddermühle abzweigt, "die alte Bach" ! Der Name "Wehrbach", den
Zimmermann in "Hanau Stadt und Land" angibt, ist mir völlig fremd.
In meinen Kinderjahren waren die Ufer der "Katzebach" innerhalb der
Stadt durch etwa zwei Meter hohe Mauerwände eingefaßt. Wo die
"Katzebach" die Straßen kreuzte, führte eine Brücke über
sie: so an der Ostheimer Straße bei der Hochmühle, in der Judengasse,
in der Straße nach meinem Elternaus, dem Pflücksburger Hof,
in der Hauptstraße am Rathaus, in der Spitalgasse und in dem an sie
anschließenden Teil der Neugasse.
Des Weiteren erinnere ich mich noch zweier öffentlicher Stege für
Fußgänger: der eine bildete die Fortsetzung des Ganges vom Marktplatz
zwischen den Häusern des Kammachers Pfeiffer und des Küfermeisters
Petert Westphal (in dessen Hausflur ich noch deutlich die Schnitzbank stehen
sehe). Der andere breitere Steg, stellte die Verbindung her zwischen der
"Guten Gasse" und "Kirchpfad" einerseits und dem Platz vor der Kirche,
andererseits. Außerem sind mir zwei Privatstege in der Erinnerung:
der eine im Anschluß an den Hof des Kirchenherrn Georg Dahl, der
andere an den seines Nachbars Heil und vor diesem Jokob Lind. Wo die "Katzebach"
Hofreiten durschschnitt, hatten sich die Eigentümer auf eigene Kosten
in Hofesbreite feste Holzbrücken von Zimmerleuten erstellen lassen.
So zum Beispiel der Metzgermeister Daniel Reul, der Vater meines Altersgenossen
Peter Reul.
Das "Wässerchen" trieb zwei Mühlen
Ein Rätsel ist mir, woher dieses kleine Wässerchen die Kraft
nahm, kurz hintereinander zwei Mühlen zu treiben, die "Hochmühle",
früher die "Mühle zum hohen Rad" genannt, und die im Hofe des
"Amtshauses" am linken Rand der "Katzebach" stehende Mühle. Meines
Erachtens findet das seine Erklärung nur darin, daß bei der
"Hochmühle" das Wasser von oben her das Mühlrad in Bewegung setzte
- also oberschlächtig-, bei der anderen dagegen von unten - also unterschlächtig
wirkte und der dadurch erzielte Höhenunterschied die Strömung
verstärkte. Heute sind diese beiden Mühlen eingegangen, die Hochmühle
um 1886 nach dem Tode ihres Besitzers Heinrich Achatius Menger, und die
Mühle im Hofe des Amtshauses im Dreißigjährigen Kriegs,
also vor mehr als dreihundert Jahren.
Die letztgenannte Mühle war wahrscheinlich dem Grafen von Hanau
gleichzeitig mit dem Bau der Stadtmauer errichtet worden mit dem Zweck,
in Fehdezeiten, wo die Stadttore geschlossen werden mußten, Burg
und Stadt mit Mehl zu versorgen, was die beiden anderen Mühlen, die
"Hochmühle" und die "Niddermühle" nicht konnten, da sie außerhalb
der Stadtmauer lagen. Nachdem aber die Burg und die Stadt im Dreißigjährigen
Kriege 1635 und 1646 zum größten Teil zerstört worden waren,
hatte die Mühle des Amtshauses weder für die gräfliche Herrschaft
noch für die Windecker Bürgerschaft irgendwelche Bedeutung. Sie
wurde deshalb nicht wieder aufgebaut. Am längsten hielt sich die gleichaltrige
Niddermühle. Sie stellte, soweit mir bekannt, erst vor wenigen Jahren
den Betrieb ein.
Daß aber die für gewöhnlich so harmlos sich hinschleichende
"Katzebach" zu einem reißenden Strome ausarten kann, hat sie im Sommer
1883 bewiesen. Es war am Nachmittag des 30. Mai, an einem Mittwoch, als
ein außergewöhnlich schweres Gewitter von Westen her über
Windecken hinweg zog. Es blitzte und donnerte gewaltig, regnete aber nicht
übermäßig. Desto schlimmer aber tobte es sich über
Ostheim und Marköbel aus. In Marköbel schlug der Blitz in die
Spitze des 1868 erbauten Kirchturms ein und zündete. Das Feuer verzehrte
nicht nur das Dach des Turmes, sondern auch das ganze Holzwerk in seinem
Inneren bis auf die unterste Etage und ließ nur verkohlte Reste zurück.
Der Glockenstuhl brach zusammen, die Glocken fielen herab, die kleinste
schmolz.
In den Gemarkungen der beiden Orte Ostheim und Marköbel ging ein
wolkenbruchartiger Regen nieder, der in kürzester Zeit die weiten
Ackerfluren in große Seen verwandelte. Die aus der Ostheimer Gemarkung
kommende "Katzebach" schwoll schnell an, stieg aus ihren Ufern und wälzte
ihre Wassermassen Windecken zu, wo man von der herannahenden Katastrophe
nichts ahnte, die beide Nachborte heimgesucht hatte Die über die "Katzebach"
führenden Brücken hemmten die Strömung. Die wildgewordenen
Wasserwogen wälzten sich in die Straßen und in die Häuser,
sodaß die im Parterre Wohnenden in die oberen Stockwerke flüchten
mußten.
Zum Glück war das schauerlich schöne Schauspiel der ungezähmten
"Katzebach" nur von kurzer Dauer. Nach etwa zwei Stunden fiel das Wasser
und der Bach floß wieder ruhig dahin, als wenn nichts geschehen wäre.
Desto größer war jetzt die Aufregung bei den von Überflutung
Heimgesuchten, als sie sahen was das Wasser ihnen in der kurzen Zeit für
Schaden gebracht hatte. Für sie ging jetzt die Arbeit an, das zurückgebliebene
Lehmwasser aus Stuben, Küchen und Kellern wieder zu entfernen und
alles zu reinigen. Im Hause des unmittelbar an der "Katzebach" gelegenen
Hauses des Präsenzers Hochstadt sah ich den angerichteten Schaden.
Nahezu einen halben Meter hoch stand das Wasser in sämtlichen Parterreräumen.
Eimer-und zuberweise wurde das Lehmwasser aus den Zimmern getragen. Alle
vorhandenen Möbel und anderen Gegenständie waren völlig
verdreckt, die Tapeten aufgeweicht und sie mußten ersetzt werden.
In einem anderen Haus mußte sogar der Fußboden neu gedielt
werden. Zu den Aufregungen, dem Ärger und Verdruß auch noch
die unvorgesehenen Geldausgaben. In unserem Hause war nichts Sonderliches
geschehen. Das Wasser hatte gerade die oberste Stufe der Haustreppe erreicht.
Das unfreiwillige Schlammbad des Gendarmen
Heute bietet sich an der "Katzebach" ein ganz anderes Bild. Sie ist
kanalisiert. In ihrem ehemaligen Bette liegen hohe Zementrohre, die das
Wasser unsichtbar der Nidder zuführen. Eine schöne, breite gepflasterte
Straße geht über sie weg. Ob aber die Weite der Zementrohre
das Wasser bei einem neuen katastrophalen Wolkenbruch alle fassen kann,
wird die Zukunft lehren.
Ein anderes Bild von der "Katzebach" ist mir in Erinnerung geblieben.
Der Gendarm führte einen Betrunkenen, aber sonst gutmütigen,
harmlosen Einwohner zu dessen Ernüchterung nach dem "Judenturm" und
schlug, um Aufsehen zu vermeiden, den näheren und wenig belebten Weg
der "Katzebach" entlang ein. Die lieben Nachbarn ließen sich aber
das Schauspiel nicht entgehen. Das ärgerte den Betrunkenen, er weigerte
sich weiterzugehen und wurde schließlich ausfallend. Es gab ein Ringen
zwischen ihm und dem Gendarmen und potzpardauz lag er zusammen mit seinem
Häftling in der "Katzebach" zum Gaudi der zuschauenden Menge.
Da rief der Gendarm laut: "Meine Herren! Herr X und Herr Y! Im Namen
des Gesetzes fordere ich sie auf, mir beizustehen. Selbstverständlich
kamen nun die Männer dieser Aufforderung nach und führten den
nassen Häftling und den ebenso durchfeuchteten wie völlig verschmutzten
Gendarmen zur nächsten Treppe in der Einfassungsmauer des Baches.
Der Weitermarsch nach dem "Judenturm" verlief ohne Zwischenfall und lachend
gingen die Zuschauer wieder an ihre Arbeit. Ich war damals zehn Jahre
alt und auf mich hinterließ der Wortlaut der Aufforderung des Gendarmen
an die Zaungäste dieses Vorfalls einen tiefen Eindruck."
Soweit die Erinnerungen von Heinrich Karl Bach über die früher
offen durch Windecken fließende "Katzebach." Die Verrohrung innerhalb
der früheren Stadtmauer erfolgte erst Anfang des 20. Jahrhunderts.
Infolge der sehr schnell einsetzenden Schneeschmelze trat der Bach im Frühjahr
1940 über die Ufer und die Wassermassen wälzten sich hinter dem
Eisenbahnviadukt über die Ostheimer Straße in Richtung Windecker
Ortskern. Damals war im Nidderstädtchen eine Artillerieeinheit einquartiert
und die Soldaten versuchten verzweifelt, durch Absperrmaßnahmen die
reißenden Fluten des sonst so harmlosen Baches in eine bestimmte
Richtung zu lenken. Die beiden Fotos von der Überschwemmung 1940 stellte
freundlicherweise Reinhard Wolff zur Verfügung. Für die Reproduktion
zeichnet Rolf Hohmann verantwortlich.
 |
| Grossansicht
laden |
© GVW 2000 |
| Bei der großen Überschwemmung
im Frühjahr 1940 wälzten sich Wassermassen über die Ostheimer
Straße |
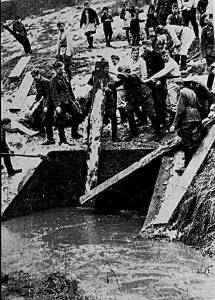 |
| Grossansicht
laden |
© GVW 2000 |
| Die einquartierten Soldaten bemühten
sich wie hier am Bahndammdurchstich verzweifelt, die aus Ostheim kommenden
Fluten so abzuleiten, daß sie im Windecker Ortskern keine größere
Schäden anrichteten. |
|



