|
|
Der Fall Bausch (I)
Die Frage nach dem Motiv bleibt unbeantwortet
Von Rolf Hohmann
|
 |
| Grossansicht laden | © GVW 2000 |
Fünf der acht Bausch-Enkel bei einem kürzlichen Familientreffen in Langendiebach.
Von Links: Karl, Charlotte, Kurt, Lisa und Gastgeberin Marie. Sitzend Bausch-Tochter Maria Schäfer
Foto: Rolf Hohmann
|
Mit meinem Schreiben vom 2. September 2001 an das Einwohnermeldeamt der
Stadt Gießen, begannen intensive Recherchen des Geschichtsvereins
Windecken 2000 mit dem Ziel, die vielen Widersprüche in der
"Fälscherstory" um den Windecker Brunnenbauer Georg Bausch
aufzuhellen, sofern dies nach so langer Zeit noch möglich ist.
Gesucht wurde nach der Bausch-Enkelin Erna S., die mich mit Schreiben
vom 24. August 1972 fast schon flehentlich gebeten hatte, den von
Gudrun Loewe gegen ihren Großvater erhobenen Vorwurf des
Fälschens der "Wetterauer Brandgräber" zu entkräften
(War der Brunnenbauer Georg Bausch ein Meisterfälscher?). Da ich damals neben meiner
beruflichen Tätigkeit vollauf damit beschäftigt war, die
Notbergungen auf dem Areal des einstigen römischen Erdkastells
Heldenbergen zu organisieren (Ausgrabungen im Römerkastell
Heldenbergen), schloß ich
nach anfänglichen Erkundungen zunächst die angelegte Akte
Bausch, und die Angelegenheit geriet in Vergessenheit. Doch die
Bausch-Enkelin Marie Schmidt (Langendiebach) wollte sich nicht damit
abfinden, daß man ihren Großvater in der Fach- und
Populärliteratur aufgrund eines sich ausschließlich auf
Indizien basierenden Vorwurfs weiterhin als Fälscher der
"Wetterauer Brandgräber" bezeichnet. Der Verfasserin des 1958 in
der "Germania" veröffentlichten Beitrags "Zur Frage der Echtheit
der jungsteinzeitlichen "Wetterauer Brandgräber" warf sie vor, in
Windecken nicht mit Einwohnern, die Georg Bausch noch kannten, das
Gespräch gesucht zu haben. Wie beispielsweise mit Johannes Kurz,
der als Ausgrabungshelfer viel zur Aufklärung des Falls hätte
beitragen können. Auf Wunsch von Maria Schmidt versucht der
Geschichtsverein Windecken seit über anderthalb Jahren den von
Gudrun Loewe erhobenen Vorwurf zu entkräften oder zumindest zu
relativieren, daß die "Wetterauer Brandgräber" nebst
allen Beigaben "von Bauschs Hand herrührten" (Gudrun Loewe). Die
Nachforschungen konzentrieren sich auf die Jahre 1907 und 1908, in
denen auf eng begrenztem Raum auf dem "Tannenkopf" nahe Butterstadt 32
bandkeramische Brandgräber mit ebenso viel
Kieselstein - Schmuckketten als Beigaben entdeckt und ausgebeutet wurden.
Erstmals eingehend mit diesem Themenkreis befasste sich Hermann
Müller-Karpe 1943 in seiner Abhandlung "Zur
Originalitätsfrage der Wetterauer Brandgräber" (Mitteilungen
des Hanauer Geschichtsvereins e.V. 1943/Februar 1944). Bis zu diesem
Zeitpunkt war deren Echtheit "als solche" von keinem Prähistoriker
ernsthaft angezweifelt worden. Etwas anders verhielt es sich mit den
Grabbeigaben in Form von gelochten Schmuckketten, vor allem aus
Kieselsteinen. In seiner Inaugural-Dissertation von 1938 "Die
Rössener Kultur in Südwestdeutschland" erwähnt Armin
Stroh auch kurz die "Wetterauer Brandgräber" und in einer
Fußnote merkt er an: "Eine eingehende kritische Untersuchung der
Kieselketten und vor allem der "Anhänger" wäre dringend
geboten. Mindestens sollten sie, solange eine solche nicht
stattgefunden hat, nicht zu irgendwelchen Schlüssen oder
Beweisführungen herangezogen werden." Armin Stroh betont aber in
seiner Arbeit ausdrücklich: "Da die Brandgräber als solche
sicher sind, mag das eine oder andere auch der Rössener Kultur
angehören, aber wohl nur der südwestdeutschen Stichkeramik."
Zu einem völlig anderen Schluß kommt Gudrun Loewe 1958 in
ihrem erwähnten Beitrag, der nach 45 Jahren von mir einer
kritischen Betrachtung unterzogen wurde. Nach Auswertung der gleichen
Quellen, die auch der Autorin zur Verfügung standen, einer ganzen
Serie von Bohrversuchen an Kieselsteinen und interessanten Angaben in
den erst kürzlich aufgetauchten Erinnerungen von Theodor Jung,
weichen meine Schlußfolgerungen teilweise erheblich von ihren
Feststellungen ab. Meine in mehreren Beiträgen
zusammengefaßten kritischen Bewertungen erheben keinesfalls
den Anspruch, eine wissenschaftliche Abhandlung darzustellen, sondern
sie sind eine Betrachtung aus der Sicht eines "vorbelasteten"
Journalisten. Ich beschäftige mich immerhin seit 1967 intensiv mit
der Vor- und Frühgeschichte speziell unseres Raums, und meine
Bücher- und Quellensammlung zu diesem Themenkreis kann sich
durchaus sehen lassen. Außerdem verfüge ich als Autodidakt
über einige Ausgrabungspraxis und kann schon ein
charakteristisches, jungsteinzeitliches Gefäßbruchstück
von einem Artefakt aus späteren Kulturepochen unterscheiden.
Immerhin habe ich vor allem für meine intensiven Bemühungen
um eine wissenschaftliche Untersuchung der von Baumaßnahmen
bedrohten Überreste des römischen Erdkastells Heldenbergen
und als Gründer der "Volkskundlichen und archäologischen
Arbeitsgemeinschaft südliche Wetterau" mit Sitz in Nidderau
bereits 1976 aus der Hand des Ministerpräsidenten Albert Osswald
den Ehrenbrief des Landes Hessen erhalten.
Mich interessierte die Frage, ob das Fälschen von Artefakten einen
Straftatbestand darstellt. Da ich von Juristen aus meinem
Bekanntenkreis keine eindeutige Antwort erhielt, die mir zur
Verfügung stehende Literatur und auch das Internet in diesem
speziellen Fall nicht weiter halfen, wandte ich mich an das Hessische
Ministerium der Justiz. Ich fragte an, ob das Fälschen vor- oder
frühgeschichtlicher Bodenfunde (Artefakte) mit der Absicht, diese
beispielsweise Antiquitätenhändlern zu verkaufen, oder
Wissenschaftler bloßzustellen, ein Straftatbestand nach dem StGB
darstellt und und wenn ja, mit welcher Strafe zu rechnen sei? Das
Antwortschreiben der Sachbearbeiterin Weisbart vom 24. Februar 2003
(Az.: 3133/1E-III-74/03) hat folgenden Wortlaut: "Auch ich
befürchte, dass ich Ihnen eine eindeutige Antwort auf Ihre Fragen
nicht geben kann. Zu Ihrer Frage zu den Straftatbeständen ist zu
sagen: Das Strafgesetzbuch nennt in § 263 den Straftatbestand des
Betrugs. Dieser könnte anzuwenden sein, wenn jemand vor- oder
frühgeschichtliche Bodenfunde mit der Absicht fälscht, sie
Antiquitätenhändlern zu verkaufen. Voraussetzung ist
allerdings, dass dies in der Absicht geschieht, sich einen
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen. Die Strafandrohung
ist im Regelfall Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe. Zu
denken wäre im Zusammenhang mit Antiquitäten, wenn es um ein
Zertifikat ginge, noch um den Tatbestand der Urkundenfälschung
nach § 267 StGB. Wenn es um das "Bloßstellen" einer Person
geht, etwa wenn ein Dritter in seinem Ruf geschädigt werden
sollte, kämen noch die Tatbestände der Beleidigung und der
üblen Nachrede nach den §§ 185 und 186 StGB in Betracht.
Das heutige Strafgesetzbuch geht in seinen Wurzeln auf das
"Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich von 1871" zurück. Ich
gehe davon aus, dass die oben geschilderten Tatbestände von ihrem
Grundsatz her auch in der Zeit von 1906 bis 1910 galten."
 |
| Grossansicht laden | © GVW 2000 |
Diese Steinketten aus der Gemarkung Butterstadt/Marköbel sind verschollen
Repro: Rolf Hohmann
|
Nun schließt Müller-Karpe irgendwelche "Dunkelmänner"
nicht aus, die Georg Bausch zu ungesetzlichem Tun angestiftet und ihm
entsprechende "logistische" Unterstützung gewährt haben
könnten: "Es bliebe dann allerdings einen im Hintergrund
arbeitenden raffinierten Altertumshändler oder dergl. anzunehmen,
der mit Bausch unter einer Decke gesteckt habe" (S. 15). Dazu
könnte eine ältere Windecker Einwohnerin wichtige Angaben
beitragen. Leider ist sie nicht zu einer entsprechenden Aussage bereit.
Gudrun Loewe hat offensichtlich keinen Gedanken daran verschwendet,
welches Motiv so übermächtig gewesen sein sollte, daß
sich aus dem biederen Brunnenbauer und Familienvater "von heute
auf morgen" ein "Meisterfälscher" mit beachtlicher krimineller
Energie entwickelte. Was aber hätte den übereinstimmend als
"einfachen Menschen" geschilderten Brunnenbauer dazu veranlassen
können, viele hundert von in der Größe genau
abgestimmten Kieselsteinen wahrscheinlich aus dem für ihn weit
entfernten Main (in der Nidder gibt es keine freiliegenden
Kiesbänke) mühselig aufzusammeln, sie an einem "geheimen Ort"
mit einem uns unbekannten Gerät zu durchbohren und diese teilweise
zu verzieren? Was trieb ihn weiter an, diese "Steinketten" in steter
Gefahr, von Spaziergängern oder Landwirten in Sichtweite des
Dorfes Butterstadt bei seinem Tun entdeckt zu werden, kurzfristig in
"getürkten" Brandgräbern mit anderen Beigaben und
Leichenbrand so zu deponieren, daß selbst bedeutende
Prähistoriker der damaligen Zeit diese "Fälschungen am
Fließband" nicht bemerkt haben sollten? Mit dieser Unterstellung
degradiert Gudrun Loewe die hochrangigen Fachwissenschaftler, die vor
dem Ersten Weltkrieg die Freilegung vieler "Wetterauer
Brandgräber" vor Ort verfolgten, oft selbst Hand anlegten und nie
einen ernsthaften Fälschungsverdacht äußerten, in
meinen Augen zu Dilettanten.
Begleitet von Pressemitteilungen, wird der Geschichtsverein Windecken
2000 auf seiner Homepage in zwangloser Folge die Ergebnisse seiner
intensiven Recherchen der Öffentlichkeit vorstellen. Die
Abhandlungen von Hermann Müller-Karpe und Gudrun Loewe haben wir
weitgehend im Wortlaut auf der Website
"www.geschichtsverein-windecken.de" veröffentlicht. Da daraus oft
zitiert wird, sind als Quellenangaben die Kürzel
MK=Müller-Karpe und GL=Gudrun Loewe gewählt worden.
Hinzugefügt wird jeweils die entsprechende Seitenangabe. Hier ist
anzumerken, daß die maschinengeschriebene Arbeit von MK aus zwei
Teilen besteht. Um die Sache nicht unnötig zu komplizieren, habe
ich die Seiten beider Teile von 1 - 16 durchnummeriert. Wie ich
ansonsten aus den von mir gesammelten Quellen zitieren werde, ist im
Beitrag "Der bandkeramische Kulturkreis in der Literatur" auf unserer
Homepage dargelegt.
Wir haben uns bemüht, den Lebensweg der vier handelnden
Hauptpersonen dieser "Fälscherstory" in Kurzform nachzuzeichnen:
 |
| Grossansicht laden | © GVW 2000 |
Das kürzlich aufgestockte Haus Brunnengasse 6 in Windecken
Foto: Rolf Hohmann
|
Georg Bausch wurde am 10. Mai 1866 in Windecken geboren. Am 1. Januar
1899 heiratete er Maria Hetterich aus Marköbel. Aus dieser Ehe
gingen acht Kinder (5 Jungen und drei Mädchen) hervor. Davon lebt
noch Maria Schäfer (geb. 1913), die in Langendiebach wohnt. Im
Kirchenbuch der evangelischen Gemeinde Windecken wird bei der Taufe
seines Sohnes Georg Heinrich am 29. November 1903 der Vater als
"Brunnenmacher" bezeichnet. Ob Georg Bausch diesen Beruf erlernte oder
sich die entsprechenden Fähigkeiten aneignete, ist nicht bekannt.
Sicher scheint zu sein, daß er beim "Buddeln" im
fundträchtigen Lößboden der südlichen Wetterau auf
Artefakte stieß, die sein Interesse an der Vor-und
Frühgeschichte weckten. Georg Bausch hatte nach
übereinstimmenden Berichten eine außergewöhnliche
Spürnase für prähistorische Siedlungsspuren. Auch den
Römern, vor allem im Bereich des Limeskastells Marköbel, war
er erfolgreich auf der Spur. Bereits früh wurde der
Streckenkommissar bei der Reichs-Limeskommission, Prof. Dr. Georg
Wolff, auf Georg Bausch und dessen besonderen Fähigkeiten
aufmerksam. Dieser war als "freier Ausgräber" tätig und
verkaufte seine Funde an den Hanauer Geschichtsverein und andere
Interessenten. Das war zu jener Zeit legal, wenn von den
Wissenschaftlern auch nicht gerne gesehen. Um Bausch nicht vollends auf
den Weg des Handels mit Bodenaltertümern abzudrängen,
beauftragte ihn Professor Wolff, für die Römisch-Germanische
Kommission die Felder der Hohen Straße nach Fundorten
abzusuchen,"diese aber, wenn möglich, nicht auszubeuten, sondern
nur für Ausgrabungen vorzubereiten" (MK S.8+9). Später war er
für das Historische Museum Frankfurt als Vorarbeiter tätig,
ehe er 1920 im Alter von 54 Jahren Spaten und Spatel aus der Hand
legte.
Das Verhältnis von Georg Bausch zu seinem Mentor beschreibt
Müller-Karpe in seiner Abhandlung wie folgt: "Bausch selbst sei
"in vielerlei Hinsicht eigenartig" gewesen. Äußerst
zutraulich und offenherzig allen Menschen (auch Prähistorikern)
gegenüber. Gern ließ er sich als "Limesforscher Bausch"
bezeichnen. Bis an sein Lebensende, ja bis an sein Sterbebett, hat er
oft und gerne von Prof. Wolff erzählt, dem er so viel verdanke und
an dem er in geradezu kindlicher Weise hing" (S. 3). Sollte Georg
Bausch dieses in ihn gesetzte Vertrauen und die ihm von seinem
Förderer so oft bewiesene Fürsorge dadurch aufs Spiel gesetzt
haben, indem er skrupellos und aus unerfindlichen Gründen ganze
Serien von jungsteinzeitlichen "Brandgräbern" und deren Beigaben
fälschte, die der von ihm so verehrte Professor in seinen
Veröffentlichungen als "sensationelle" Entdeckungen pries? Bausch
mag man nach allem, was Zeitgenossen über ihn aussagten, als etwas
naiv bezeichnen, doch so einfältig konnte er wahrlich nicht
gewesen sein anzunehmen, daß diese "Massenfälschungen"
zwischen 1907 und 1910 nie entdeckt werden könnten und damit "sein
Professor" in den Ruch eines Scharlatans gekommen wäre. Mit
solchen "banalen" Überlegungen hat sich Gudrun Loewe
offensichtlich nie befasst. Georg Bausch starb am 28. September 1932 in
seinem 1914 in Windecken erworbenen Haus Brunnenstraße 6 als
Entdecker der "Wetterauer Brandgräber" und geachteter
Mitbürger.
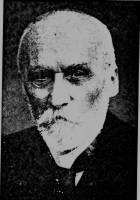 |
| Grossansicht laden | © GVW 2000 |
Prof. Dr. Georg Wolff in hohem Alter
Repro: Rolf Hohmann
|
Als Professor Dr. Dr. h.c. Dr.ing.e.h. Georg Wolff am 6. November 1929
in Frankfurt am Main verstorben war, wurde sein Lebenswerk in
verschiedenen Publikationen mit längeren Beiträgen
gewürdigt. Im "Hanauisches Magazin" erschien in Nummer 1/2 des
Jahrgangs 1930 ein mehrseitiger Nachruf von Rudolf Welcker, dem
wir folgenden Auszug entnehmen:
"Georg Wolff wurde am 29. August 1845 zu Neuenhain im Kreise Ziegenhain
geboren. Seine Jugendjahre verlebte er in Schwarzenfels im Kreise
Schlüchtern. Er besuchte 1858 bis 1865 das Gymnasium zu Fulda und
studierte in München Philologie und Geschichte. Die
Lehramtsprüfung legte er in Marburg am 9. November 1869 ab; am 5.
März 1872 wurde er von der philosophischen Fakultät der
Universität Marburg zum Doktor promoviert. Seine
Lehrtätigkeit begann er im Januar 1870 an der Hohen Landesschule
zu Hanau, wo er bis Ostern 1889 wirkte. In diesem Jahr wurde ihm,
nachdem er die Direktorenstelle an dieser Anstalt abgelehnt hatte, die
Stelle eines ersten Oberlehrers am Kaiser-Friedrich-Gymnasium zu
Frankfurt a.M. übertragen. Ostern 1910 in den Ruhestand versetzt,
stellte er sich bei Kriegsausbruch seiner Schule sofort wieder zur
Dienstleistung zur Verfügung.
Georg Wolff war Streckenkommissar bei der Reichs-Limeskommission,
stellvertretender Direktor der Römisch-Germanischen Kommission des
Archäologischen Instituts des Deutschen Reiches, sowie
ordentliches Mitglied des Archäologischen Instituts, Ehrendoktor
der philos.-naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität
Frankfurt a.M. und Doktor-Ingenieur der Technischen Hochschule zu
Darmstadt. Die Berliner Akademie der Wissenschaften verlieh ihm 1913
die Leibnizmedaille für Kunst und Wissenschaft; die
Geschichtsvereine zu Hanau, Frankfurt, Kassel, Darmstadt, Wiesbaden und
Gießen sowie der Gesamtverein der Deutschen Geschichts- und
Altertumsvereine machten ihn zu ihrem Ehrenmitglied.
Wolff war ein ausgezeichneter Lehrer von hervorragenden menschlichen
und pädagogischen Qualitäten, daneben aber ein Forscher, der
auf dem Gebiete der römisch-germanischen und vorgeschichtlichen
Bodenforschung bahnbrechend gewirkt und so ein zwiefaches Lebenswerk
geschaffen hat. Er war ein Mann, der keinen Feind gehabt hat und dessen
ritterliche Gesinnung auch jeden Neider entwaffnen mußte, ein
treuer Sohn der hessischen Heimat und der getreue Ekkehard der
deutschen Geschichts- und Altertumsvereine, besonders des Hanauer
Geschichtsvereins."
 |
| Grossansicht laden | © GVW 2000 |
Prof.Dr. Hermann Müller-Karpe bei Entgegennahme der Ehrendoktorwürde der Universität Bratislava
Repro: Rolf Hohmann
|
Am 10. Oktober 1996 wurde im Rahmen einer Festsitzung Prof. Dr. Hermann
Müller-Karpe die Würde eines Doctor honoris causa der
Komensky-Universität Bratislava (Preßburg) verliehen. In der
aus diesem Anlaß herausgegebenen Festschrift heißt es:
"Für die Komensky-Universität ist es eine Ehre, Herrn Prof.
Dr. Hermann Müller-Karpe den Ehrentitel Doctor honoris causa
für große Verdienste um die Entwicklung auf dem Gebiet der
Wissenschaft, Kultur und des Hochschulwesens, sowie für die
großzügige Unterstützung der Forschung in der Slowakei
zu verleihen." Aus dieser Festschrift sind nachfolgend die wichtigsten
Lebensdaten des Geehrten entnommen. Hermann Müller-Karpe wurde am
1. Februar 1925 als Sohn eines Studienrates in Hanau geboren. Nach dem
Besuch des Realgymnasiums begann er an der Uni Graz ein Studium, wurde
aber kurz darauf zum Wehrdienst eingezogen und geriet in amerikanische
Gefangenschaft. Vom Wintersemester 1945/46 studierte Müller Karpe
an der Uni Marburg Vorgeschichte, Klassische Archäologie, Alte
Geschichte, Klassische Philologie und Kunstgeschichte. Das Studium
schloß er mit der Promotion am 9. April 1948 ab. Nach kurzer
Tätigkeit im Museum Kehlheim trat Müller-Karpe am 1. Mai 1948
in den Dienst des Hessischen Landesmuseums Kassel, wo er die
vorgeschichtliche Abteilung betreute. Am 1. Januar 1950 wechselte er an
die Praehistorische Staatssammlung München. Dort war er bis 1960
zuletzt als Konservator beschäftigt.
Neben seiner Museumstätigkeit habilitierte sich Müller-Karpe
im Februar 1958 an der Universität München und wurde zum
Privatdozenten ernannt. Vom Sommersemester 1959 bis zum Wintersemester
1961/62 vertrat er den Lehrstuhl für Vor- und Frühgeschichte
der Iniversität Würzburg und lehrte vom Oktober 1963 als
ordentlicher Professor an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in
Frankfurt am Main. Nach Gründung der Kommission für
Allgemeine und Vergleichende Archäologie des Deutschen
Archäologischen Institutes wurde Hermann Müller-Karpe 1979 zu
deren Erstem Direktor gewählt. Am 1. Januar 1980 trat er sein Amt
an und leitete den Aufbau dieses Instituts in Bonn und dessen
Forschungsaktivitäten bis 1987. Seine wissenschaftlichen Leistungen
fanden Ausdruck in seiner Wahl und Ernennung zum Mitglied in
zahlreichen wissenschaftlichen Korporationen in Deutschland, der
Schweiz, Italien, Japan, Großbritannien und in der Slowakei. Die
archäologischen Aktivitäten von Hermann Müller-Karpe
erstreckten sich auf alle vor- und frühgeschichtlichen
Zeitabschnitte und viele Kulturbereiche bis China, Afrika und Amerika.
Widmete er sich in der Anfangszeit seiner wissenschaftlichen Laufbahn
vor allem der Bronze- und Früheisenzeit, so wandelten sich mit
Beginn seiner Universitätstätigkeit auch seine Publikationen.
Parallel zu seinen Vorlesungen entstanden unter anderem das
mehrbändige Werk "Handbuch der Vorgeschichte" sowie verschiedene
Monographien. Neben seiner akademischen Lehre, legte Professor
Müller-Karpe auf die Forschung ebensolchen Wert. Dabei führte
er nicht so sehr seine vor Antritt der Franfurter Professur begonnenen
Unternehmungen weiter, sondern organisierte und förderte eine
neues, großes Projekt, das für die Kupferzeit-, Bronzezeit-
und Früheisenzeitforschung von größter Bedeutung wurde:
die systematische Erforschung, Bearbeitung und Edition der
"Prähistorischen Bronzefunde." Es würde den vorgegebenen
Rahmen sprengen, alle Aktivitäten dieses engagierten und
vielseitigen Vor-und Frühgeschichtsforschers auch nur
annähernd zu würdigen. Das Festschrift-Kapitel "Lebenslauf,
wissenschaftliche, pädagogische und organisatorische
Tätigkeit" des Ehrendoktors der Komensky-Universität
Bratislava verfasste Prof. PhDr. Mária Novotná, Dr. Sc.
Ihr Schlußsatz lautet: "Insgesamt gilt Hermann Müller-Karpe
auch in der Slowakei als Vorbild in seiner akademischen Verbindung von
Forschung und Lehre, wobei das konkret Archäologische ebenso zur
Geltung kommt wie das allgemein Historische und beides einen
gesamtglobalen Rahmen der Menschheitsgeschichte bildet." Professor Dr.
Hermann Müller-Karpe genießt heute seinen verdienten
Ruhestand in Königswinter.
Gudrun Loewe wurde am 28. Januar 1914 in Kiel geboren. Sie studierte in
Kiel, Hamburg, Tübingen und Jena Vorgeschichte, Geographie und
Anthropologie. Im Jahr 1943 erlangte sie mit ihrer 100 Seiten
umfassenden Inaugural-Dissertation "Die Kultur mit Schnurkeramik im
Lande Thüringen" den Doktorgrad der Hohen Philosophischen
Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Nach
Tätigkeiten als wissenschaftliche Angestellte an der Uni-Jena, im
Amt für Bodendenkmalpflege Darmstadt und im Rheinischen
Landesmuseum Bonn, wechselte Gudrun Loewe 1965 nach Schleswig. Dort war
sie im Landesamt für Vor- und Frühgeschichte von
Schleswig-Holstein als Dezernentin für die archäologische
Landesaufnahme zuständig. "Aus ihrer Feder stammen mehrere
Monografien und zahlreiche Aufsätze, die in einschlägigen
Fachschriften zu finden sind, und sie als gute Kennerin der Vor- und
Frühgeschichte ausweisen", heißt es in ihrem Nachruf. Dr.
Gudrun Loewe trat am 31. Januar 1979 in den Ruhestand und sie starb
80jährig am 18. Februar 1994 in Bäk (Amt Ratzeburg-Land).
Es ist nicht auszuschließen, daß meine Gegenargumente zur
Arbeit von Gudrun Loewe, besonders von involvierten
Prähistorikern, nicht unwidersprochen hingenommen werden. Ich bin
als Laie gerne bereit, mich der Diskussion zu stellen. Hier meine
Anschrift:
Rolf Hohmann
Höhenstraße 2
61130 Nidderau
Telefon: 06187/22831 - Fax 27482
E-Mail: rolf-hohmann@t-online.de
|
© Geschichtsverein Windecken
2000
Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Vereins.
|



